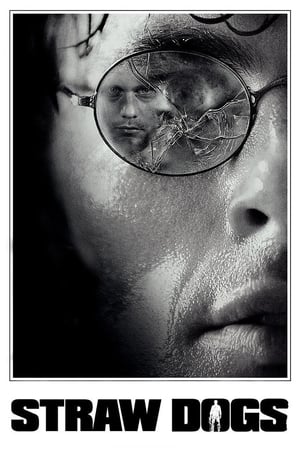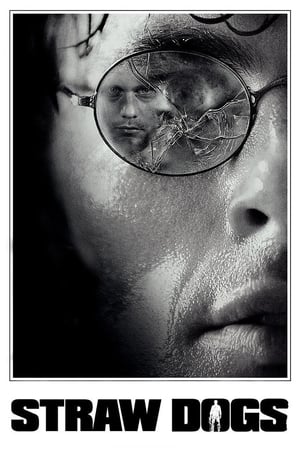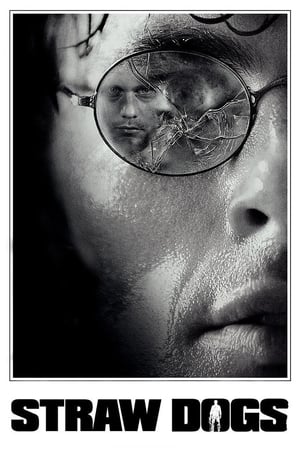Bilder, die memorable Durchschlagskraft atmeten: Nichts anderes hat Sam Peckinpah im Jahre 1971 mit„Wer Gewalt sät“, seiner ungemein eindringlichen Studie über die Genese von Gewalt, kreiert: Ein kühler, gleichwohl auch anmaßender Kopf namens David (famos gespielt vom jungen Dustin Hoffman) sah sich gezwungen, seine pazifistische Gesinnung von Grund auf über den Haufen zu werfen, um mit gewaltverseuchter, aber gleichwohl antizipierender Ratio den tobenden Mob vor der Haustür in die Schranken zu weisen. Was Sam Peckinpah in seinem als 'Skandal' verschrieenen Meisterwerk perspektivierte, war die Freilegung des territorialen Imperativs, dem blank geschaufelten Triebverhalten, um im nächsten Schritt ebenso zu verdeutlichen, dass diese Veräußerung des animalischen Impulses eben auch in die Selbstzerstörung führt: Alle hat er sie kaltgemacht, realisiert David, noch wie benommen vom vorherigen Blutrausch. Er selber wird fortan aber auch nur noch als leere Hülle durch die Welt schreiten, heimatlos und derangiert.
Wie es heutzutage nun mal Gang und Gäbe ist, müssen selbst die Filme auf den modernen Stand gebracht werden, die man einfach nicht besser machen kann. So war es wohl auch nur eine Frage der Zeit, bis „Wer Gewalt sät“ sein entsprechendes Remake spendiert bekommt: 30 Jahre nach seiner Uraufführung, kam „Straw Dogs – Wer Gewalt sät“, dieses Mal inszeniert von Rod Lurie, in Kinos und bestätigte einen elendigen Trend bis auf die Knochen: Alles, was das Original richtig gemacht hat, was den Film so wertvoll gemacht hat, wird von der Neuauflage überrannt und bereits in Ansätzen ruiniert. Es ist verständlich, dass man bei einem Film wie „Wer Gewalt sät“ nur den Kürzeren ziehen kann, jede thematische Konnotation wurde bis zum Ende gedacht, ohne irgendetwas auf tumbe Allgemeinplätze zu verschieben und dem Zuschauer das Denken zu erübrigen: „Wer Gewalt sät“ hat auch noch Tage nach dem Abspann beschäftigt, zu intelligent, aber eben auch provokativ ging es dort vonstatten.
Zu erbarmungslos wurde jeder einzelne Moment über die in barbarischer Fasson kultivierten Ambivalenzen hergeleitet. Und nun kommt das Remake, eine Mimikry, die sich auf die Agende geschrieben hat, Sam Peckinpahs cineastisches Faszinosum bis auf einige Abänderung exakt zu plagiieren. Herausgekommen ist dabei ein Streifen, der sich mit formvollendeter Debilität brüsten darf, nicht aber mit 'feiner Psychologisierung', wie ihm irritierenderweise vielerorts nachgesagt wird. Angesiedelt in den sonnendurchfluteten Südstaaten, entkräftet sich Rod Luries Imitation allein schon aufgrund der abwesenden Rohheit in der Bildästhetik. Cornwall war verregnet, spröde, komplett vom Grau eingenommen und beinahe schon unwirtlich, in diesem „Straw Dogs – Wer Gewalt sät“ hingegen ist es ein uriges Provinznest, in dem man gerne mal den ein oder anderen Sommer verbringen würde. Ein James Marsden ist zudem mit seinem festgewachsenen Perlweißgrinsen selbstredend kein Dustin Hoffman, genauso wenig wie die durchaus solide Kate Bosworthden charakterlichen Dualismus im Gebaren der Susan George vermissen lässt.
„Straw Dogs – Wer Gewalt sät“ simplifiziert kategorisch all das, was „Wer Gewalt sät“ noch unfassbar tiefgehend herausarbeitete. Dass hier von Beginn an nichts im Argen brodeln darf, sondern David und der muskulöse Hüne Charlie Venner (Alexander Skarsgard) sich offensichtlich schon beim ersten Augenkontakt gerne die Zähne gegenseitig zu fressen gegeben hätten, rückt die induktive Entwicklung der Geschichte in den luftleeren Raum. Da ist es dann nur passend, dass die Vergewaltigung von Amy auch eindeutig als eine solche zu identifizieren ist und die Kamera sich stetig am Sixpack von Charlie Venner festsaugt, während die Körper ohnehin von einem immanenten Schweißfilm glänzen dürfen. Eine so signifikante, weil eben auch emblematische Szene im Original, wird hier auf ihre schiere Eindimensionalität heruntergebrochen: „Straw Dogs – Wer Gewalt sät“ kennt nur Schwarz und Weiß, er scheucht seine Geschichte in massiver Einfältigkeit über den Bildschirm und lässt all die erschütternde Menschlichkeit vermissen, mit der sich Peckinpah noch bis tief ins Mark bohren konnte.
Bezeichnend ist es daher auch, dass „Straw Dogs – Wer Gewalt sät“ gerne als 'Rache-Thriller' tituliert hat. Wohl eine Bezeichnung, die Sam Peckinpah wild im Grabe rotieren ließe, würde man seinen Film mit einer derartigen Kategorisierung belegen. Wenn im letzten Akt dann das Blut fließt und die legendär-symbolische Bärenfalle zum Einsatz kommen darf, führt „Straw Dogs – Wer Gewalt sät“ seine Charaktere nicht in die innere Ohnmacht, sondern erlaubt ihnen eine Katharsis, weil ihre Gewalt hier niemals einer affektiven Reaktion unterliegt, sondern immerzu mit jeder Klarheit ausgeführt wird: Die vom Schreck weit aufgerissenen Augen eines Dustin Hoffmans, als er einem der Belagerer Schrot in den Fuß jagte, sind passe, stattdessen packt James Marsdan die Nagelpistole aus und tackert die Hand eines Widersachers an die Wand, damit ihm die Scherben des Fensters langsam die Kehle aufschneiden. Ohnehin mag es schon der falsche Weg gewesen sein, David als Drehbuchautoren und Amy als Schauspielerin darzustellen, um eine billige Meta-Ebene dann in einer noch billigeren Läuterungsfarce versiegen zu lassen. So harsch es auch formuliert sein mag: Das Original scheint man nicht so recht verstanden zu haben.
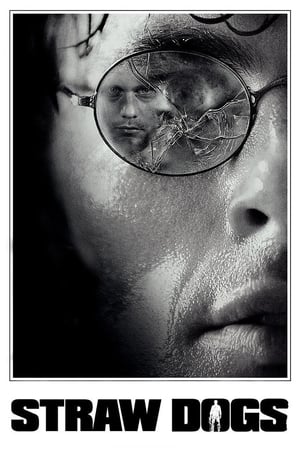 Trailer
Trailer