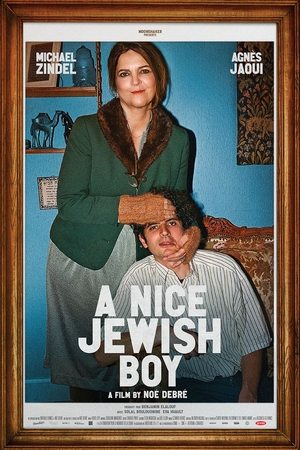Gesehen beim 30. Jüdischen Filmfestival Berlin Brandenburg
„Ich ziehe Filme dem Leben vor.“
Der Regisseur und Drehbuchautor Alexandre Arcady (Der Boss) verewigte in The Blond Boy From The Casbah seine eigene Lebensgeschichte. Er kam 1947 in Algier zur Welt und wanderte mit fünfzehn Jahren zusammen mit seiner Familie nach Frankreich aus. Der Grund für die übereilte Flucht aus Algerien war die angespannte politische Situation im Land, die mit der Entkolonialisierung von Algerien zusammen hing. Algerien wurde bereits im Jahre 1830 von Frankreich erobert und wurde zu einer kolonialen Provinz. Die Diskriminierung der algerischen Bevölkerung führte insbesondere in den 1950er-Jahren zu starken Protesten und Attentaten. Das Leben in seiner Heimat war nicht mehr sicher, deswegen musste Alexandre mit seiner Familie fliehen. Jahre später verarbeitete er die Erlebnisse während seiner Kindheit in einem Buch „Le petit blond de la casbah“ und nun sogar in einem Film. The Blond Boy From The Casbah erzählt die Geschichte eines Regisseurs (Patrick Mille, They Were Ten) der mit seinem Sohn in seine Heimat zurückkehrt, um ihm die Geschichte seiner Kindheit zu erzählen. In Rückblicken sieht man ihn als einen kleinen blonden Jungen (Léo Campion, The Time of Secrets), der mit seiner Großfamilie in einem ärmlichen Viertel lebt, in dem alle möglichen Nationalitäten und Religionen friedlich nebeneinander existieren, bis sich die politische Lage zuspitzt.
Muslimische, katholische und jüdische Menschen wohnen hier Seite an Seite und feiern gemeinsam das Leben. Antoines Familie ist arm, zahlt ihre Miete nie pünktlich, hat nicht immer Strom und kann sich geradeso etwas zu Essen kaufen, doch sie sind glücklich. Sie lachen, sie tanzen und sind in einer starken Gemeinschaft verwurzelt. Auch wenn man den Eindruck bekommt, dass der Regisseur Alexandre Arcady seine eigene Kindheit durch eine rosa-rote Brille sieht, kann man es ihm nicht verübeln, weil er den Ort seiner Kindheit gegen seinen Willen verlassen musste und alles, was schlimm und dunkel war, wurde in seinen Erinnerungen offenbar weitestgehend durch das Gute ersetzt oder entschärft. Auch das Eifersuchtsdrama zwischen seinen Eltern wird ziemlich entspannt dargestellt und obwohl sein Vater (oder zumindest die Figur im Film) krankhaft eifersüchtig war und seine Mutter (Marie Gillain, Die einfachen Dinge) ständig verdächtigte, ihn mit dem Gemüsehändler oder mit dem Fleischlieferanten zu betrügen, wird es im Film eher als ein Running Gag dargestellt und die Wut des Vaters (Christian Berkel, Das Experiment) verfliegt ziemlich schnell. Beide Figuren sowohl, die Figur des Vaters als auch die Figur der Mutter sieht man aus der Sicht des Antoine und es entsteht der Eindruck, dass er beide Eltern vergöttert hat: die tanzende wunderschöne Mutter und der starke Vater, der Ernährer der Familie. Auch seine Oma steht oft im Mittelpunkt als eine liebevolle ältere Dame, die ständig vor der Tür sitzt und Mandeln zerkleinert oder ein Mittagsschläfchen macht. Nur seine Brüder sind meistens nicht mehr als ein Beiwerk.
Neben seiner Familie spielt für Antoine die größte Rolle in seinem Leben das Kino und während er in einem dunklen Kinosaal sitzt und auf die Leinwand starrt, vergisst er alles um sich herum. Es fallen keine Bomben, es werden keine Menschen verletzt und wen doch, dann registriert er das nur, wenn es auf der Leinwand geschieht. Schon vor seiner echten Flucht, flieht er mit seinen Gedanken an die Orte, der Filme, die er sich im Kino ansieht. Der junge Hauptdarsteller Léo Campion bringt diese Leidenschaft und die Liebe für Filme ausgezeichnet rüber und der ältere Darsteller Patrick Mille spielt mit Wehmut und Sehnsucht nach Vergangenheit überzeugend einen gestandenen Mann, der zum Ursprung seiner eigenen Geschichte zurückkehrt. Um sich selbst wirklich zu kennen, muss man seine Vergangenheit kennen und Alexandre Arcady setzt sich zur Genüge mit seiner Vergangenheit auseinander, die ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er jetzt ist, ein erfolgreicher Regisseur. In The Blond Boy From The Casbah ist die Realität so stark mit der Fiktion verbunden, dass man meistens den Eindruck gewinnt, dass alles echt ist. Die Darstellung ist authentisch und schön. Wir dürfen an den Kindheitserinnerungen des Regisseurs teilhaben und kehren mit ihm an einen Ort zurück, der nicht mehr existiert. So viele Menschen, die gemeinsam lebten, wurden auseinandergerissen, weil die Politik über sie hin wegrollte. Sie dachten nicht an die Kolonialisierung, sie waren eine große glückliche Gemeinschaft, bis der Krieg sie auseinanderriss …
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org