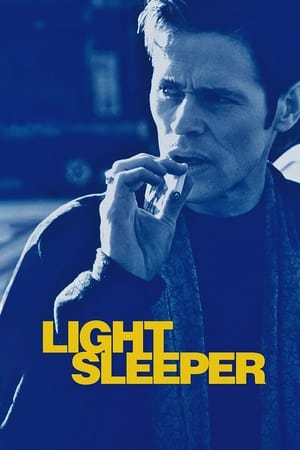Männer, die alleine in einem Raum sitzen, eine (metaphorische) Maske tragen und darauf warten, dass etwas passiert - so beschrieb Paul Schrader im Interview mit The Hollywood Reporter den archetypischen Protagonisten, zu dem er im Laufe seiner Karriere stets zurückgekehrt ist. Diese metaphorische Maske sei dabei meist Profession – Taxifahrer, Gigolo, Drogendealer, Priester. In The Card Counter begegnen wir einer Figur, die die Maske eines Pokerspielers trägt. Der schweigsame William Tell (OscarIsaac) vertreibt sich tagsüber seine Zeit an Spieltischen in Las Vegas, abends schreibt er im Halbdunkel seiner Hotelzimmer in Tagebücher, die anschließend im Papierkorb landen. Das ist kein Leben, sondern schlicht Daseinsbewältigung. Die Vergangenheit streckt ihre blutigen Finger nach Tell aus.
10 Jahre hat Tell, eigentlich Bill Tillich, in einem Militärgefängnis vebracht - für seine Taten im Foltergefängnis Abu Ghuraib, in dem er während des Irakkriegs stationiert war. Seine Erinnerungen an die scheußlichen Menschheitsverbrechen, die er dort beobachtet und selbst verübt hat, präsentiert Schrader in Rückblenden. Die Bilder sind verzerrt und machen schwindelig, das proportinale Gefüge dieses Welten- und Seelenkellers ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Tell ist dieser Hölle entkommen, nur um jetzt im Fegefeuer eines Alltags zu darben, den er nicht verdient. Er hofft auf Läuterung oder Erlösung, auf egal welchem Weg. Oder, wie andere Schrader-Protagonisten vor ihm, einfach darauf, dass etwas passiert.
Mit Cirk (Tye Sheridan) und La Linda (Tiffany Haddish) treten zwei Menschen auf den Spielplan, die Tell aus seiner existenzielen Lethargie reißen. Mehr noch: Sie bieten ihm eine Chance auf einen Neuanfang. Der junge Cirk möchte Tell für seine rachsüchtigen Pläne konsultieren; Tell willigt ein, hofft aber, den Jungen von seinem Vorhaben abzubringen. Aus der anfangs reingeschäftlichen Beziehung zu La Linda entschält sich derweile behutsam echte Zuneigung. Schrader wahrt dabei stets eine faszinierte Distanz zu seinem Triumvirat gequälter Seelen. Es ist ein unsentimenaler, aber trotzdem gefühlvoller Blick auf Menschen, die sich im schicksalhaften Moment ihres Zusammentreffens genau das geben können, was sie brauchen. Bis die Seifenblase platzt.
Die hyperdigitalen Bilder von The Card Counter machen die Figuren platt und zweidimensional. Als wären sie nichts weiter als Projektionen, zeichnen sich Körper immer wieder gegen die Unschärfe ihrer Hintergründe ab. Sie sind attraktiv und gut gekleidet, essen, trinken und sprechen. Aber sie sind auch flach, leer, gespenstisch. Der Film rückt sie in eine entlarvende Sichtbarkeit, betont das Maskenhafte. Es ist fesselnd diese Figuren dabei zu beobachten, wie sie um ein neues Innenleben ringen. Natürlich folgt der Pfad zur Läuterung aber einer Schleifenlogik. Am Ende fallen die Masken und enthüllen teuflische Fratzen. Der Vergangenheit entkommt man nicht so einfach.
Wie in vielen anderen seiner Filme begnügt sich Schrader aber nicht mit diesem tragischen Eingeständnis. The Card Counter ist kein hoffnungsloser Film. Das von Schrader schon oft zitierte Schlussbild aus Robert Bressons Pickpocket, einem seiner Lieblingsfilme, findet auch seinen Weg in diese Geschichte. Die ist nicht neu. Aber Schraders Inszenierung, gleichermaßen präzise und ambivalent, rührend und doch unsentimental, verleiht ihr Frische und Vitalität. Letztendlich ruht der Film auch auf den Schultern von Hauptdarsteller Oscar Isaac, zuletzt etwas verloren in der Tristesse schauspielerunfreundlicher Blockbuster, dessen brodelndes und nuanciertes Maskenspiel der Schauspielkunst gemahnt, die in Schweigsamkeit liegen kann.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org