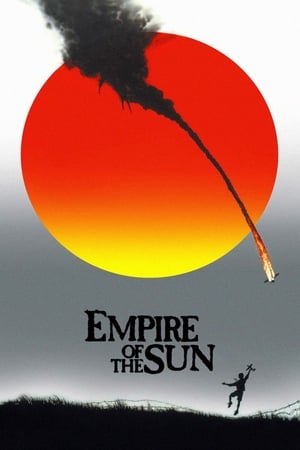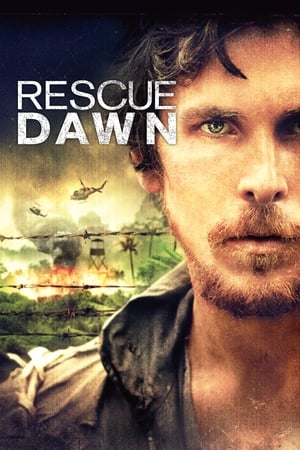Kritik
„Wenn man den Tod vor Augen hat, gleicht jede Sekunde einer Ewigkeit.“
Dass sich Ernest Gordon (Ciarán McMenamin, Saving the Titanic) dazu entschieden hat, im zweiten Weltkrieg für sein Land in die Schlacht zu ziehen, erklärt der ehemalige Geschichtsstudent damit, allen Kriegen ein Ende setzen zu wollen. Er wolle selber Teil der Geschichte werden. Ob sich hinter dieser Aussage ein pazifistisches oder dann doch eher ein nationalistisches Anliegen verbirgt, scheint sich durch Gordons Dienst an der Waffe wohl recht einfach auflösen zu lassen, doch To End All Wars – Gefangen in der Hölle von David L. Cunningham (Wintersommerwende) aus dem Jahre 2001 bemüht sich um Ambivalenzen und verzwickte Moralvorstellungen, wenn er ein auslaugendes Porträt englischer, schottischer und amerikanischer Soldaten anfertigt, die 1942 nach dem Fall von Singapur in japanische Kriegsgefangenschaft geraten und maßgeblich dafür verantwortlich waren, die sogenannte Todeseisenbahn zu erreichten.
Der Bau der Bahnstrecke des Todes, von der 110 Kilometer in Myanmar und 305 Kilometer in Thailand liegen, wurde bereits im unsterblichen Klassiker Die Brücke am Kwai von David Lean thematisiert, in dem die Gefangenen eines japanischen Lagers in Burma unter extremen Bedingungen dazu gezwungen wurden, eine hölzerne Eisenbahnbrücke über den Mae Nam Khwae Yai zu errichten. Bis heute gilt das Kapitel der Konstruktion der Thailand-Burma-Eisenbahn als Gnadenlosbeispiel der japanischen Kriegsverbrechen im zweiten Weltkrieg (neben der Besetzung der Mandschurei und den daraus resultierenden biologischen wie chemischen Experimenten). Nachdem Gordon in der Exposition des Films noch einmal in einer feurigen Rede auf die Loyalität der Armee rekurrieren darf, erwartet den Zuschauer einen Schnitt später bereits die Hölle am Kwai: Gefesselt werden die Soldaten einen von aufgespießten Köpfen gesäumten Steg entlanggetrieben.
Daraufhin bedient sich Regisseur David L. Cunningham den erzählerischen Konventionen klassischer Kriegsgefangenen-Filme und dokumentiert den Lageralltag, erforscht die Gruppendynamik und stellt die Frage zum Diskurs, wie lange es dauert, bis die Insassen jede Menschlichkeit und jede Würde verlieren. Die größte Stärke von To End All Wars – Gefangen in der Hölle ist dabei der Umstand, wie hier mit Feindbildern gearbeitet wird: Erst werden die japanischen Aufseher vollkommen eindimensional aufgebaut, dämonisch überhöht, bis ihnen mit der Zeit Brüche zustehen. Denn auch die Japaner sind Gefangene; Gefangene ihrer Kultur, ihres Glaubens, ihrer Ideale, ihrer Identität. Mag sich Cunninghams Inszenierung auch etwas zu ausschweifend mit den Gräuel des Lagers befassen, was der Gewalt zwar nicht ihrer Durchschlagskraft entledigt, sie aber auch auf negative Art als erschöpfend darstellt, besitzt dieser Film eine nicht zu unterschätzende Nachreife.
Die Fotografien und das Nachzeichnen der brutalen Vorgänger bleiben durch die bildsprachliche Nüchternheit im Gedächtnis. Mit der Handkamera bewaffnet verschreibt sich To End All Wars – Gefangen in der Hölle einem fast schon dokumentarischen Wesen, welches höchstens durch das philosophisch-angehauchte Voice Over der Hauptfigur und dem manchmal etwas zu grobschlächtig auf der affektiven Klaviatur spielenden Score von John Cameron aufgebrochen, aber nie ernsthaft verflacht wird. Dafür beschreibt Cunningham zu organisch diese von der Außenwelt hermetisch abgeschirmte Mikrogesellschaft des Grauens, in der Hoffnungslosigkeit und Angst regieren, in der aber auch Freundschaft möglich ist. Eine Freundschaft, wie die des echten Ernest Gordon und dem ehemaligen kaiserlichen Übersetzers Takashi Nagase, die sich am 4. Februar 2000 auf dem Friedhof der Bahnstrecke des Todes trafen, innehielten, die Vergangenheit Hand in Hand ruhen, aber nicht vergessen ließen.
 Trailer
Trailer