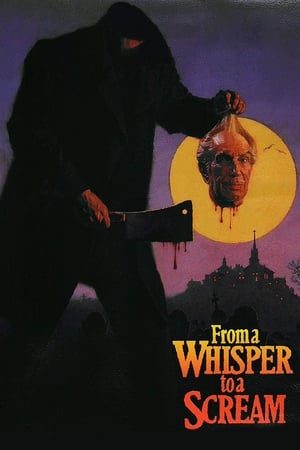Die im US-Fernsehen zwischen 1959 und 1965 ausgestrahlte Serie The Twilight Zone zählt zu den wohl einflussreichsten TV-Shows aller Zeiten und war für seine Zeit bahnbrechend. Woche für Woche wurden in den rund 25minütigen Episoden voneinander unabhängige, in sich geschlossene Geschichten erzählt, die von unheimlichen, übernatürlichen und fantastischen Ideen handelten, die in ihrer Kreativität bis heute noch aktuelle Filme und Serien beeinflussen. Speziell in den USA genoss die Serie bereits damals schon Kultstatus und wurde in regelmäßigen Abständen immer mal wiederbelebt, wobei nichts an den Impact der Originalserie anknüpfen konnte. Die inspirierte auch viele spätere Filmemacher maßgeblich, und so suchte sich niemand geringerer als der 1983 wohl heißeste Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (E.T. – Der Außerirdische) gemeinsam mit seinem zu jener Zeit ebenfalls sehr erfolgreichen Kollegen John Landis (An American Werewolf in London) zwei weitere Regisseure für eine Kino-Hommage der beliebten Serie. Das Konzept: vier Regisseure inszenieren (wie in der Serie) vier in sich geschlossenen, voneinander unabhängige Kurzgeschichte, verknüpft lediglich durch einen gemeinsamen Pro- und Epilog. Letzter wie die erste Episode wurden von John Landis, die zweite von Steven Spielberg selbst inszeniert. Für die anderen beiden Abschnitte wurden Joe Dante (Gremlins – Kleine Monster) und George Miller (Mad Max) angeheuert. Ein absolutes Herzens- und Prestigeprojekt, dass jedoch direkt zu Drehbeginn von einem beispiellos tragischen Unfall am Set überschattet wurde.
Dieser ereignet sich während der Aufnahmen zur ersten Geschichte Time Out von John Landis (die einzige Story, die nicht auf einer Original-Idee der Serie beruht). In dieser zieht der frustrierte Bill (Vic Morrow, The Last Jaws – Der weiße Killer) nach einer verpassten Beförderung hemmungslos über alle „Randgruppen“ her, die ihm und seinem Erfolg vermeidlich im Weg stehen. Juden, Afroamerikaner, Araber, Asiaten – nichts und niemand ist von seinem antisemitischen und fremdenfeindlichen Ansichten sicher. Als er die Bar verlässt, findet er sich plötzlich im Nazi-besetzten Frankreich wieder. Von diesen fast zu Tode gehetzt erwacht er erneut, diesmal in den US-Südstaaten, wo er von Mitgliedern des Ku-Klux-Klans für einen Farbigen gehalten wird und nur knapp der Lynchjustiz durch den Sprung in einen Fluss entkommt. Nur um während des Vietnam-Kriegs wieder aufzutauchen, wo er diesmal von amerikanischen GIs flüchten muss. Die Zeitreisegeschichte über ganz schlechtes Karma ist durchaus reizvoll, ist natürlich von seinem Läuterungsprozess in der kürze der Zeit aber nicht wirklich effektiv und kann kaum losgelöst von der realen Tragödie betrachtet werden.
Da auch John Landis während des Drehs klar wurde, dass sein Protagonist lediglich durch die aufgestülpte Opferrolle nicht ernsthaft tragisch oder zumindest etwas reumütig erschien, entschied man sich kurzfristig für eine so im Originaldrehbuch nicht vorhandene Szene, in der Bill im Vietnam-Szenario zwei Kinder aus einem unter US-Beschuss stehenden Dorf retten sollte. Dazu musste Darsteller Vic Morrow mit der sechsjährigen Renee Shin-Yi Chen und dem siebenjährigen Myca Dinh Le einen künstlichen Fluss durchqueren, während sie von einem Hubschrauber verfolgt wurden. Dieser geriet durch die Explosionen von Pyroeffekten außer Kontrolle, wodurch Morrow und der Junge vom Rotor des Helikopters enthauptet und das Mädchen von einer Kufe durchbohrt wurde. Alle waren unmittelbar tot. Trotz alledem wurden die Dreharbeiten nicht gestoppt, da die der anderen Episoden sowieso unabhängig davon stattfanden. Das der Film danach überhaupt veröffentlicht wurde lag vom rein Pragmatischen daran, dass das grundsätzliche Material für diese Folge fertig war, und vom Marketingtechnischen daran, dass das Studio keinen Steven Spielberg-Film einfach wegwerfen wollte. Rein ethisch extrem fragwürdig wenn nicht sogar noch mehr. Später distanzierte sich einige der Beteiligten – mal mehr, mal weniger deutlich - von dem Projekt und u.a. John Landis wurde der Prozess wegen fahrlässiger Tötung gemacht, wovon er 1987 freigesprochen wurde. Alles in allem eine schier unfassbare Geschichte, trotzdem steht am Ende ein Film, den man auch unabhängig davon irgendwie beurteilen muss und sollte.
Die von Steven Spielberg inszenierte Geschichte Kick the Can spielt in einem Altenheim, wo der Neuankömmling Mr. Bloom (Scatman Crothers, Shining) die Bewohner*innen dazu animiert, ihren kindlichen Spieltrieb wieder auszuleben. Mit fantastischen Folgen. Während die anderen Storys schon mehr dem Horror- und Gruselgenres zuzuordnen sind, ist Spielbergs Part ein leider extrem kitschiges Fantasy-Märchen, das nicht mal über ausgeprägte, inszenatorische Finesse oder eine wirklich emotional ergreifende Message verfügt. Es ist sogar der eindeutige Schwachpunkt des gesamten Projekts, der dezent wirkt wie eine grobschlächtige Blaupause zu Ron Howards kurz danach erschienenen Kassenschlager Cocoon. Wem der noch nicht kitschig genug war, bekommt hier die volle Breitseite substanzloser Feel-Good-Zuckerwatte injiziert. Danach geht es immerhin deutlich bergauf, wenn auch mit einem erheblichen Absacker, als es gerade richtig schön hätte werden können.
Denn It’s a Good Life von Joe Dante verfügt über die vielleicht spannendste Prämisse mit dem meisten Entfaltungsmöglichkeiten, die leider zum Ende etwas zu deutlich ihrer Experimentierfreude erliegt. Als Helen (Kathleen Quinlan, Breakdown) auf dem Parkplatz eines Diners den 10jährigen Anthony anfährt, bringt sie ihn schuldbewusst nach Hause. Dort wartet bereits seine Familie und empfängt auch Helen äußert gastfreundlich zum Abendessen. Doch die gute Stimmung trügt, denn es gibt einen Grund, warum alle Familienmitglieder dem Nesthäkchen etwas mehr Honig ums Maul schmieren, als es pädagogisch sinnvoll angebracht wäre. Der Auftakt ist interessant, die Grundprämisse klasse und wenn das ganze nicht gen Ende in einen viel zu abstrusen Cartoon-Trip umkippen würde, das hätte ein echter Hit werden können. So lassen sich eventuell noch die für die Zeit außergewöhnlichen Effekte theoretisch loben, obwohl gerade die aus heutiger Sicht extrem schlecht gealtert wirken und mit dazu beitragen, dass dieser Part einen sehr seltsamen Beigeschmack besitzt.
Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss und der gebührt George Miller mit Nightmare at 20.000 Feet, aber noch viel mehr seinem Hauptdarsteller John Lightgow (Konklave), der als von Todesangst gepeinigter Flugpassagier komplett die Hütte abreist. Als dieser, ohnehin mit Flugangst gestraft, entdeckt er während eines turbulenten Fluges als einziger eine merkwürdige Kreatur auf der Tragfläche, die offenbar den Flieger bewusst zum Absturz bringen will. Nur keiner mag ihm glauben. Eine schon wirklich oft anderweitig adaptierte Idee (beruhend auf eben jener klassischen Episode der TV-Serie), die auch hier den eindeutigen Highlight-Charakter hat. Lithgow spielt herausragend und die Prämisse ist für einen 20 Minuten-Slot einfach perfekt. Sie retten auch das Gesamtprojekt letztlich deutlich, denn bis dahin ist zwar jederzeit Engagement und Leidenschaft für die ursprüngliche Vorlage zu erkennen, die Qualität lässt aber überwiegend ziemlich viel Luft nach oben. Mal ganz abgesehen davon, ob die Fertigstellung des gesamten Projekts nicht ohnehin mehr als nur diskutabel war.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org