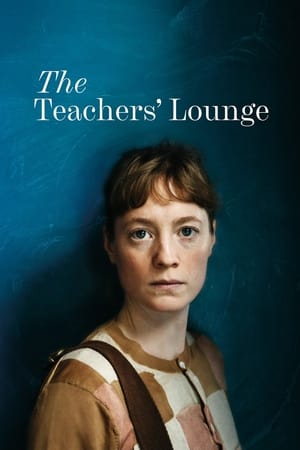Mit Vena legt eine neue Regiestimme im deutschen Kino ein beachtliches Debüt vor. Ein leises, aber eindringliches Stück Milieukino, das sich der sozialen Realität mit ungewöhnlicher Empathie und stilistischer Klarheit nähert. Ohne Pathos, ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit umso größerer emotionaler Wucht erzählt der Film von Menschen am Rand der Gesellschaft und davon, wie schwer es ist, sich dort einen Rest an Selbstbestimmung zu bewahren.
Im Mittelpunkt steht Jenny (Emma Nova), eine junge Frau, die ungeplant schwanger ist. Ihre Beziehung ist instabil, geprägt von Fluchtmechanismen und einem Alltag voller Drogenkonsum. Ihren ersten Sohn Lucas hat sie bereits an ihre Mutter verloren, nun steht sie erneut unter Druck: Das Jugendamt schaltet sich ein, Jenny muss sich Unterstützung durch eine Familienhebamme holen. Die skeptische Annäherung an Marla (Friederike Becht), ihre zugewiesene Betreuerin, bildet das emotionale Rückgrat des Films. Aus dem zunächst funktionalen Kontakt entwickelt sich vorsichtige Nähe, eine Verbindung, die Jenny Halt gibt, neue Perspektiven eröffnet und sie Schritt für Schritt ins Leben zurückführt. Doch als sich allmählich alles zu stabilisieren scheint, droht Jennys Vergangenheit erneut alles zu gefährden.
Was Vena so besonders macht, ist das Vertrauen in die eigene Erzählung. Die Kamera bleibt nah an den Figuren, beobachtet statt zu erklären, und erschafft so eine Intimität, die tief unter die Oberfläche dringt. Der Film spielt in einem Milieu, das oft klischeehaft überzeichnet dargestellt wird: sozial prekär, urban, rau. Chiara Fleischhacker nähert sich diesem Kosmos mit Respekt, mit Sensibilität und einem feinen Gespür für Zwischentöne. Das Drehbuch lässt Raum für Leerstellen, für das Ungesagte. Das, was oft mehr erzählt als Worte. Vena ist kein Film, der seinem Publikum vorgibt, was es denken soll. Stattdessen lädt er dazu ein, genau hinzuschauen, mitzufühlen und selbst Schlüsse zu ziehen.
Emma Nova trägt den Film mit großer Präsenz. Ihre Darstellung ist nuanciert, glaubwürdig und voller innerer Spannung. Sie verkörpert eine Figur, die zwischen Verantwortung und Selbstschutz schwankt, zwischen Wut und Resignation, Hoffnung und Abgeklärtheit. Es ist die Art von Rolle, die in ihrer Ambivalenz echte Größe zeigt und Nova nutzt diese Möglichkeit mit beeindruckender Reife. Unterstützt wird sie von einem Ensemble, das durchweg stark besetzt ist, ohne je ins bloß Schauspielhafte zu kippen. Die Figuren wirken gelebt, nicht gespielt.
Erwähnenswert ist auch Paul Wollin, der als Jennys Freund Bolle eine ambivalente Figur mit stiller Wucht verkörpert. In seinem Spiel verbinden sich Nähe und Abkehr, Verantwortungslosigkeit und ein echter, wenn auch hilfloser, Wille zur Veränderung. Gerade diese Vielschichtigkeit verleiht der Beziehung zwischen Jenny und Bolle eine zusätzliche Tragik. Sie hängen aneinander, obwohl sie sich gegenseitig ins Verderben ziehen.
Besonders hervorzuheben ist die Entscheidung des Films, auf eindeutige moralische Bewertungen zu verzichten. Die Systemkritik, die in der Geschichte mitschwingt – etwa an sozialen Einrichtungen, Behörden oder der strukturellen Kälte institutioneller Abläufe – ist spürbar, aber nie plakativ. Vena will kein politisches Manifest sein, sondern ein menschliches Drama, das Strukturen sichtbar macht, indem es sie im Alltag seiner Figuren verankert. Die Fragen nach Verantwortung, Schuld und der Angst vor beidem durchziehen den Film auf eine Weise, die lange nachwirkt.
Stilistisch überzeugt Vena durch eine ruhige, fast unaufdringliche Inszenierung, die in Schlüsselmomenten jedoch enorme Kraft entfaltet. Die Bildsprache ist präzise, konzentriert und dramaturgisch durchdacht. In besonders intensiven Szenen steigert sich die visuelle Gestaltung zu einer fast überwältigenden Ausdruckskraft, die den emotionalen Kern des Films noch einmal verdichtet. Dass es sich hierbei um ein Spielfilmdebüt handelt, ist bemerkenswert.
Hier ist eine Handschrift zu erkennen, die man sich für die Zukunft merken sollte.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org