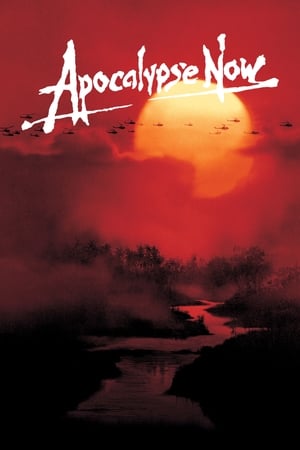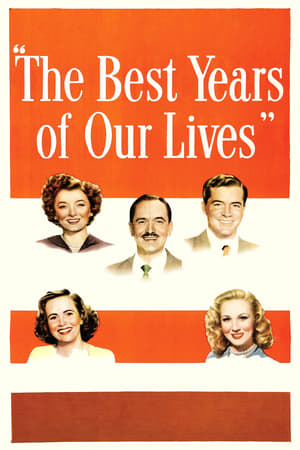Löst man einmal seinen Blick von der gigantischen Stahlwerkanlage, vom den Himmel verdunkelnden Fabrikqualm und die Ohren betäubenden Industrielärm, dann ist dieses fast schon verschlafene, von den majestätischen Alleghany Mountains gerahmte Clairton, irgendwo in Pennsylvania, von einer idyllischen Genügsamkeit geprägt, der man sich, ist man hier aufgewachsen, nur schwer entledigen kann. Nicht umsonst sagt Nick (Christopher Walken, Catch Me If You Can) in einer Szene zu seinem Freund Michael (Robert De Niro, Wie ein wilder Stier), dass ihm dieses Provinzstädtchen die Welt bedeutet. Eine Welt, die eigentlich nicht zusammenbrechen kann, so intakt zeichnet sie Michael Cimino (Im Jahr des Drachen) hier nach. Eigentlich. Das unbekümmerte Dasein allerdings wird alsbald ein jähes Ende finden, wenn die beiden Männer, zusammen mit Steven (John Savage, Der schmale Grat), in den Krieg ziehen.
Die durch die Hölle gehen, seinerzeit mit fünf Oscars prämiert worden, legt keinen großen Wert darauf, das Kriegsgeschehen in Vietnam über ausufernde Gefechtssequenzen herzuleiten. Es vergehen sogar ganze siebzig Minuten, bis Michael Cimino seine Protagonisten (und den Zuschauer somit gleich mit) durch einen harten (Ein-)Schnitt mit der alles zerfressenden und zersetzendes Feuerbrunst des Vietnamkrieges konfrontiert. Und genau diese siebzig Minuten sind es, die Die durch die Hölle gehen auf lange Sicht funktionieren lassen, benötigt Cimino diesen Zeitraum doch, um die Lebensrealität von Michael, Nick und Co. plastisch darzubieten. Diese russisch-orthodoxen Stahlarbeiter, die sich ihr ganzes Leben kennen und nun, kurz vor ihrem Abschied, noch einmal auf einer großen Hochzeit so tun dürfen, als würde es das Morgen nicht geben. Als würde sich doch nie irgendetwas verändern.
Dass über diesen ersten siebzig Minuten aber ein schwermütiger Schleier lagert, der all diesen in aller Ausführlichkeit eingefangenen Impressionen der Ausgelassenheit ein Gefühl der Endlichkeit anheftet, ist unverkennbar. Die durch die Hölle gehen beschreibt das Ende der Normalität; das Ende aller unüberlegten Hemmungslosigkeit; das Ende des Lebens. In Vietnam geraten die drei Männer in ein Gefangenenlager des Vietcong, in dem sich die Aufseher ihre Zeit damit vertreiben, nordvietnamesische und amerikanische Insassen im russischen Roulette gegeneinander antreten zu lassen. Was oftmals harsch kritisiert wurde, ist nicht nur die exakte Metapher auf die Sinnlosigkeit, die Willkür und die Grausamkeit des Krieges, sondern unterstreicht gleichwohl, dass Michael Cimino nicht daran interessiert, einen Blick auf das große Ganze zu richten, sondern die Wahrnehmung unserer Hauptdarsteller in Form einer minutiös arrangierten Ich-Konzentration abzubilden.
Der Vorwurf, Die durch die Hölle gehen bekräftige sich eines eindimensionalen Bildes der Vietnamesen, ist nachvollziehbar, lässt aber außer Acht, wie pointiert Michael Cimino die Konsequenzen des Krieges betrachtet und ausarbeitet. Deswegen gibt es in dieser unvergesslichen Sequenz, wenn sich Michael und Nick zum ersten Mal einen Trommelrevolver an die Schläfe halten müssen, nur archaische Emotionen, keine Reflexion, kein Verständnis, kein Differenzieren, nur das gnadenlose Herauskehren einer psychischen Verwüstung im Inneren dieser beiden Charaktere. Während es Michael und Steven wieder zurück in die Heimat schaffen, Michael desorientiert, Steven ohne Beine in einem Kriegsversehrtensanatorium, bleibt Nick in Saigon – für ihn gibt es die Stadt, die ihm einst die Welt bedeutete, nicht mehr. Stattdessen frönt er seiner Todessehnsucht, macht sich einen Namen bei Russisch-Roulette-Glücksspielen, sagt schlicht und ergreifend Nein zum Leben.
Besonders be- und erdrückend erweist sich die Zeit, in der Michael wieder in Clairton ist und in jeder Minute merkt, dass er eigentlich nie aus Vietnam zurückkehrte. Es gab keine Heimkehr, kein Weitermachen, sondern nur ein Entwurzeln von all dem, was in ihm einst menschlich war und nun nahezu leblos geworden ist. Michael, Nick und Steven wurden in Vietnam ausgeräumt, verheizt, zerstört, zu Abfallprodukten des Krieges verdammt, deren körperliche Verwundungen sicherlich schmerzen, das wahre Grauen aber liegt unter der Oberfläche begraben. Die durch die Hölle gehen beißt sich regelrecht fest in dieser Trümmerlandschaft, die die Gefühlswelt der drei Freunde heute ausmacht und offenbart damit einen Film über die Todessehnsucht, die Ohnmacht, das elendige Verrecken an sich und der Unmöglichkeit, zurück in das Leben zu finden.
Einen adäquateren Querschnitt durch die Gesellschaft einer langsam vor sich hin vegetierenden Nation sucht man wohl lange Zeit vergebens. Die durch die Hölle gehen ist die Innenansicht eines toten Landes, weil hier nicht nur das Leid der Veteranen thematisiert wird, sondern auch das Leid, welches auf die Freunde, Partner, Verwandte, das gesamte soziale Umfeld dadurch ausgeübt wird: Nicht umsonst darf die amerikanische Flagge nur dann wehen, wenn sie von unzähligen Leichensäcken flankiert wird. Wenn am Ende, nachdem sich Michael noch einmal nach Saigon aufgemacht hat, um seinen alten Freund Nick – beziehungsweise das, was von ihm noch übrig ist – zu retten, im kleinen Kreise God Bless America angestimmt wird, dann hat das nichts Hymnisches, nichts Pathetisches. Es ist nur der Versuch, sich gegenseitig Trost zu spenden, obgleich sich alle in dem Bewusstsein darüber sind, dass man sich damit nur bitteren Illusionen hingibt.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org