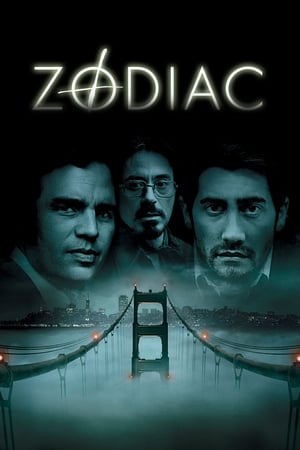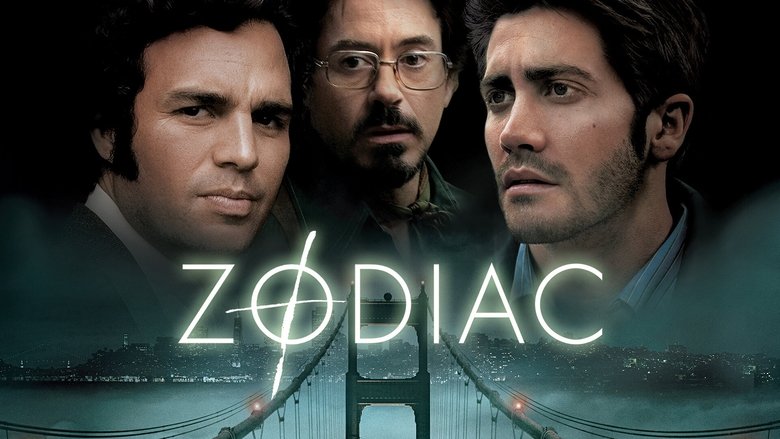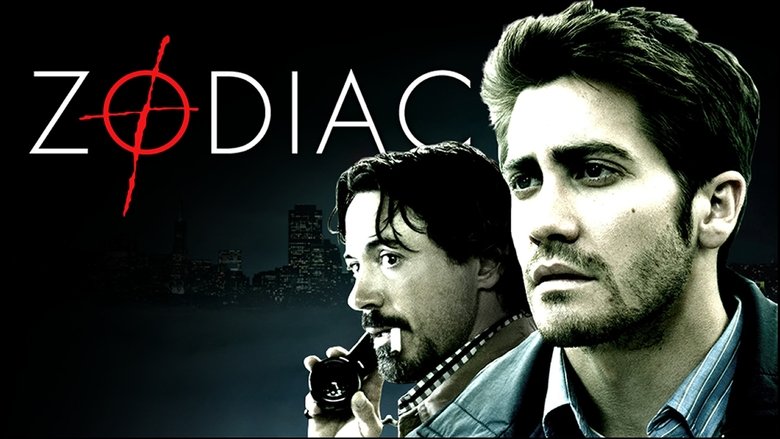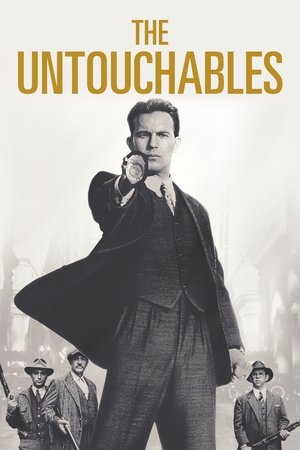Es gibt Szenenbilder in Zodiac – Die Spur des Killers, die sich zusehends wiederholen. So zum Beispiel die gleitende Kamerafahrt, die aus der Vogelperspektive einen beinahe inspizierenden Blick auf San Francisco bei Nacht wirft. Wir sehen bei diesem stilistischen Blickwinkel aus luftiger Höhe jedoch keine Westküstenmetropole, die sich langsam in den Schlaf wiegt, stattdessen dräut in diesen kartografischen Bildern eine bedrückend-ungeordnete Angst vor dem, was sich dort unten im (sub-)urbanen Raum, irgendwo in den Straßen, irgendwo in den Häusern, irgendwo in der Peripherie, abspielen könnte. Die Lichter der Großstadt, die bis an die Wolkendecke emporsteigen, sie gehen nicht von Menschen aus, sondern von Tätern. Hier veranschaulicht David Fincher (The Social Network) seine Meisterschaft, allein über seine virtuose Visualität Befindlichkeiten zu beschreiben.
David Fincher nutzt, wie so oft, unseren durch Medienkonsum vorgeprägten Blick, um ihn keinesfalls zu bestätigen, sondern das sensorische Verständnis in Bezug auf optische Reize zu torpedieren. Der Unterschied, zu Filmen wie The Game, Siebenund Fight Club, liegt darin begraben, dass Zodiac – Die Spur des Killers nicht nur visuell herausfordert und unsere allgemeine Wahrnehmung auf den Prüfstand stellt, er wagt es auch inhaltlich zu neuen Ufern aufzubrechen und, das steht programmatisch für diesen Film, Erwartungshaltungen entschieden zu unterwandern. Wer einen Film über den Zodiac-Killer dreht, einem regelrechten Konsumprodukt, welches sich seiner Zeit einen Spaß daraus gemacht hat, sich selbst (mit beachtlichem Erfolg) als Marke zu verkaufen, der muss dem Serienkiller gemäß genreinhärenter Parameter auch eine Form und somit auch eine Identität zugestehen, damit es dem Helden möglich wird, diesem im großen Finale einen Schuss zwischen die Augen zu verpassen.
Zodiac – Die Spur des Killers beschreitet andere Wege. Unter den Protagonisten befindet sich kein Dirty Harry, der sich nicht an Regeln halten muss, wie Polizist Dave Toschi (Mark Ruffalo, Spotlight) nach einer Kinoaufführung des gleichnamigen Werkes resigniert feststellt. Die Typologie der Ermittler speist sich aus geerdeten Charakter-Profilen: Da gibt es den überambitionierten Karikaturisten (Jake Gyllenhaal, Demolition), ein hochrangiger Pfadfinder, der ein Faible für das Rätselraten besitzt und den Kryptogrammen Zodiacs gnadenlos auf den Leim geht. Da gibt es den hedonistischen Paul Avery (Robert Downey junior, Stichtag), der von seinen Kollegen nur als 'versoffener Halunke' wahrgenommen wird, in Wahrheit aber eine reichlich bemitleidenswerte Figur darstellt, die durch ihren unverhältnismäßigen Alkoholkonsum mehr und mehr aus der Bahn gerät. Und natürlich Dave Toschi, keksbesessener Polizist, der keine Wunder bewerkstelligen kann, weil er, wie erwähnt, an irdische Gesetze gebunden ist.
Und vielleicht erschließt sich daraus ja auch die große Tragik, von der Zodiac – Die Spur des Killers subtextuell spricht: Die Erkenntnis darüber, dass realistische Ermittlungsarbeit eben nur nach realistischen Maßstäben funktioniert. Und vielleicht muss man sich irgendwann eingestehen, dass es Fälle gibt, die einfach nicht gelöst werden können. Die nicht gelöst werden wollen. Genau diese Ernüchterung, die aus diesem Bewusstsein keimt, nimmt einen Großteil der Tonalität von Zodiac – Die Spur des Killers ein. Der Killer selbst ist eine Chiffre, ein Schemen, bestenfalls eine krude Vermutung, die zwanghaft materialisiert werden soll, damit die Befürchtung aus der gesellschaftlichen Mitte verdrängt werden kann, dass etwas derartig Böses auch in unserem Inneren angedeihen kann. Zodiac wird zu einem Krebsgeschwür, welches sich direkt in die Schaltstellen zwischen Medien, Polizei und Volkskörper einnistet – und er liebt es, seine Metastasen streuen zu lassen.
Zodiac – Die Spur des Killers hinterfragt nicht nur die Faszination für Serienkiller, die in den Vereinigten Staaten fester Bestandteil der hiesigen Kultur ist, er offenbart nicht nur die Ungewissheit und Verzweiflung, die Hilflosigkeit und Desillusion, die sich in dem sich über Jahre erstreckenden Netz ballen. David Fincher hat einen, für seine Verhältnisse, beinahe schon kontemplativ-dokumentarischen Film über die virulente Kraft von Ängsten und Panik inszeniert. Über Obsession und Paranoia und darüber, wie man sich diese zu eigen machen kann, um dem individuellen Geltungsdrang zu frönen. Fincher verzichtet dabei auf grobschlächtige Effekthascherei, der Mann hat die Pubertät offensichtlich hinter sich gelassen, und wähnt sich vielmehr bedächtig in der lähmenden Kollektivstimmung jener Tage, in den zermürbenden Recherchearbeiten, bis sich die allseits ersehnte Wahrheit als Chimäre herausstellt. Es gibt keine Spur, kein Muster, der deutsche Beititel lügt, es gibt nur diese eine Fährte, die in unser eigenes Scheitern führt. Willkommen zur Antithese des Kriminalfilms.
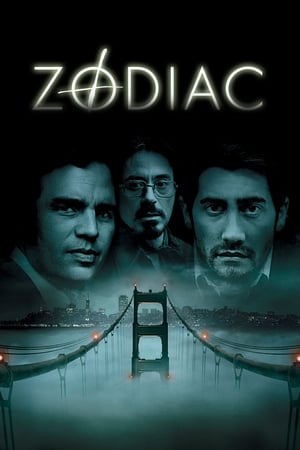 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org