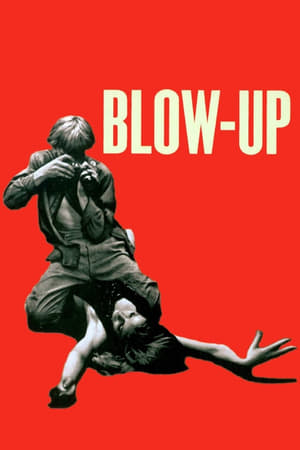Am 30. Juli 2017 sind schon ganze 10 Jahre verstrichen, seitdem Michelangelo Antonioni (Die Nacht) im Alter von 94 Jahren in Rom verstarb – am gleichen Tag übrigens, an dem auch ein gewisser Ingmar Bergman (Das siebente Siegel) verschied. Dass man dem italienischen Meisterregisseur, der die letzten Jahre seines Lebens halbseitig gelähmt und nahezu vollständig verstummt verbracht hat, wohl niemals genügend Dank dahingehend aussprechen kann, was er für die Filmgeschichte leistete, wird in jedem einzelnen seiner Werke überdeutlich. Der Filmkritiker Michael Althen schrieb in seinem wunderbaren Nachruf einst: Alles, was wir heute als modern bezeichnen, haben wir Antonioni zu verdanken. Und führt man sich cineastische Großkaliber der Marke Die mit der Liebe spielen, Liebe 1962 oder BlowUp zu Gemüte, erscheint diese Superlative selbsterklärend.
Nachdem Michelangelo Antonioni in den frühen 1970er Jahren an der Umsetzung von Tecnicamente Dolce gescheitert war, entschied er sich dazu, die Geschichte Fatal Exit von Mark Peploe zu adaptieren. Wenn man so will, ein thematisches Komplementärwerk zu seinem nie realisierten Amazonas-Projekt – und weitaus produktionsökonomischer, was sich als ein ausschlaggebender Umstand für MGM herausstellte, nachdem die Filmgesellschaft mit Zabriskie Point spürbare Verluste einfahren musste. Dass sich Beruf: Reporter heutzutage selbstverständlich ebenfalls zur Grundbildung eines jeden Filmliebhabers zählen darf, versteht sich von selbst, bringt sein mit Jack Nicholson (Zeit der Zärtlichkeit) hochkarätig in der Hauptrolle besetzter Arthouse-Klassiker doch in jeder Minute genau das zum Ausdruck, was Antonioni und sein Schaffen so bedeutsam macht: Die Leidenschaft für inner- und außerweltliche Rätsel sowie die feinfühlige Hingabe zur Dunkelheit.
David Locke (Nicholson) ist als BBC-Reporter in der Wüste des Tschad tätig. Seine Dokumentation ist so gut wie fertig, doch Kontakt zu den Guerilla-Kriegern vor Ort konnte er noch nicht aufnehmen. Schnell wird dem Zuschauer deutlich gemacht, dass Locke seinen Beruf schon lange nicht mehr (wenn er es überhaupt je getan hat) mit Passion ausübt. Ihm ist die afrikanische Kultur vollkommen egal, stattdessen sucht der Mann nur einen Ausweg, seiner alltäglich Frustration zu kommen. Als er einen Kollegen, der ihm passenderweise überaus ähnlich sieht, eines Tages tot in seinem Hotelzimmer vorfindet, ergreift er das Schicksal beim Schopfe und nimmt dessen Identität an. Michelangelo Antonioni erweckt daraufhin den Eindruck, als würde sich Beruf: Reporter für Genre-Mechaniken interessieren und eine Variation der immer schon gefragten Doppelgänger- respektive Spionage-Thriller darstellen.
Natürlich aber ist das nur eine oberflächliche stilistische Täuschung, die den Zuschauer gleichwohl auf die Persönlichkeitsstruktur des Charakters von David Locke zurückwirft. Locke nämlich erschafft ein Trugbild, um sich selbst zu entfliehen und ein Leben an sich zu reißen, in dem er losgelöst und unabhängig agieren kann. Dass jene Freiheit aber nicht dadurch zu erreichen ist, indem man kurzerhand den Pass einer anderen Person annimmt, prophezeit Michelangelo Antonioni von Beginn an mit dem Tode, der als übergeordnete Entität in jedem Frame dräut. In Beruf: Reporter ist das Ableben allgegenwärtig – und im Prinzip werden wir hier Zeuge eines Filmes, dessen Leitmotiv der Tod selbst ist. Ein Film, der die Notwendigkeit des Sterbens zum Diskurs stellt und die beflügelnde Erhabenheit destilliert, die das Ende unseres Daseins aus der Erde in sich gebärt.
Das mutet morbide und schwermütig an, doch Michelangelo Antonionis Meisterschaft bestand seit jeher darin, den düstersten und auslaugendsten Gefühlsbewegungen etwas Poetisches abzuringen. Die Geschichte eines Suchenden, der flieht, um sich schlussendlich der Todessehnsucht hinzugeben, unterstreicht sowohl die Vergänglichkeit der irdischen Existenz, versteht das Dahinscheiden aber auch immerzu als Möglichkeit, Erlösung zu finden, in dem sich das Körperliche vom Geistigen entkoppelt und in einer höheren Bewusstseinsebene Erlösung findet. Beruf: Reporter kommuniziert das natürlich über seine mal archaischen, mal fragilen Bildwelten und brennt sich als philosophische Meditation über die verborgene Schönheit des Verlassen- und Verlorenseins und als Reise in die stillen Plätze unseres Herzens in das Gedächtnis. Ein wunderbar geruhsames, den eigenen Erfahrungshorizont erweiterndes Werk, vordergründig ziellos und doch in jedem Augenblick genau dort, wo es sein muss.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org