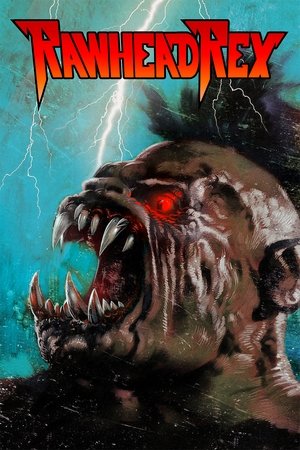Als der originale Castle Freak 1995 erschien, wirkte er bereits wie aus der Zeit gefallen. Produziert von Full Moon-Chef und Puppet Master-Schöpfer Charles Band, lose basierend auf Geschichten von H.P. Lovecraft und inszeniert von Stuart Gordon, der seine größten Erfolge Mitte der 80er mit Kult-Horror-Streifen wie Der Re-Animator und From Beyond – Aliens des Grauens hatte. Alle Beteiligten hatten ihre besten Zeiten bereits hinter sich (ob Charles Band überhaupt mal so was hatte ist schon diskussionswürdig) und der Film wirkte in vielerlei Hinsicht selbst wie irgendwo in einem alten Schlosskeller oder dem VHS-Archiv einer geschlossenen Videothek ausgegraben, doch das machte eigentlich auch seinen Charme aus. Sicherlich kein Hit, aber in mageren Genre-Zeiten ein liebenswürdiges Creature-Flick, dass sich mit einer gesunden Mischung aus Hingabe und nicht vollständiger Ernsthaftigkeit eine stabile Fanbase schuf. 2020 folgte dieses DTV-Remake, erneut produziert von Charles Band und seiner Full Moon-Schmiede. Deren Output ist mit den Jahren qualitativ alles anderer als hochwertiger geworden und inzwischen mehr als Warnung zu verstehen. Man durfte nichts Gutes erwarten, doch das Resultat spottet sogar allen skeptischen Befürchtungen: dieser Castle Freak dürfte – ohne Übertreibung – eines der miserabelsten Remake sein, das jemals auf die Menschheit losgelassen wurde.
Die Handlung des Originals wurde in etlichen Details abgeändert, im Grunde ist es aber mehr oder weniger das Gleiche in Grün. Ein (diesmal kinderloses) Paar erbt unverhofft eine alte Burg, statt in Italien nun in Albanien. Bietet sich vermutlich an, da dort wahrscheinlich sowieso gedreht wurde, hätte aber genau so gut überall anders sein können, viel zu sehen gibt es von der Umgebung eh nicht und die Kulissen beschränken sich auch auf die ewig gleichen, kargen Schlossgemäuer. Mittendrin dilettantisch agierenden Darsteller*innen, die durch die Bank unfassbar unsympathische Figuren verkörpern. Bis im letzten Drittel deren Freunde zu einer Party eingeladen werden (spontan mal nach Albanien, why not?) passiert leider auch nicht all zu viel. Der titelgebende Grottenholm schleicht zwar schon eher durch die Gegend, hält sich aber artig im Hintergrund, belauscht seine neuen Mitbewohner bei spitzenmäßigen Gesprächen (die blinde Protagonistin über ihr Kleid: „Es fühlt sich rot an“. Aha, solange da kein blaues Licht blau leuchtet, alles gut) und freut sich über deren Beischlaf, da lässt sich munter zu masturbieren. Sei ihm gegönnt, leider ist das für das Publikum nicht nur unsagbar langweilig und die gesamte Präsentation nicht weniger als eine bodenlose Frechheit.
Es gibt Fan-Fiction-Projekte (und das sogar nicht wenige), die besser, professioneller, hochwertiger und ganz besonders liebevoller aussehen als dieser Vollschrott. Der Look ist unglaublich schäbig und auch handwerklich ist das unter aller Sau. Ein so inkompetent ausgeleuchteter Film sucht beispielsweise seines Gleichen. Er ist nicht etwa zu dunkel, was man bei so was im ersten Moment annehmen sollte, sondern das genaue Gegenteil. In etlichen Szenen wirkt alles wie mit Flutlicht zugeballert, obwohl wir uns in einem fensterlosen Raum mit Kerzenschein befinden. Offensichtlich hatte da niemand auch nur den Ansatz von einer Ahnung von so etwas. Das sieht so furchtbar aus, es kann doch unmöglich niemand auffallen, das so was gar nicht geht. Regisseur Tate Steinsiek (Addiction: A 60’s Love Story) kommt eigentlich aus der plastischen Effekt-Ecke und zumindest beherrscht er das offensichtlich halbwegs. Wer jetzt aber wenigstens ein ordentlich matschiges Splatter-Fest erwartet, nicht zu früh freuen. Wenn denn endlich mal wer ins Gras beißen muss, ist das dafür auch ziemlich unspektakulär (ein Junkie bekommt seine eigene, gerade leergefixte Spritze in die Brust gerammt und kotzt eine halbe Sekunde später so was wie Erbsensuppe?!). Ein wenig ekelig wird es später tatsächlich doch noch, dann aber eher aus anderen Gründen.
Damit wären wir schon bei großen Finale und wenn man dem Film eines versuchen will anzurechnen: es ist so lächerlich und absurd, ohne eine Kopfschütteln, hämisches Lächeln oder zumindest ein saftiges „What the Fuck?“ kommt da wohl niemand raus. Das hat aber natürlich nie auch nur ansatzweise den trashigen Campy-Verve des Originals, es ist mehr die pure Fassungslosigkeit, wie man das allen Ernstes so raushauen konnte. Niemand, wirklich niemand sollte sich diesen Film anschauen. Außer als warnendes Beispiel vielleicht. Oder aus purer Selbstgeißelung, würde dann wenigstens thematisch passen.