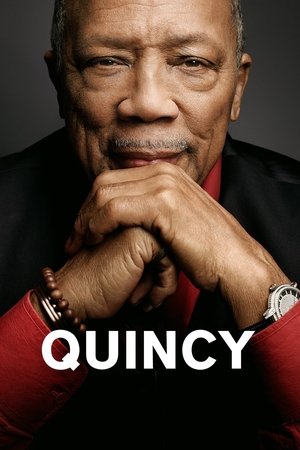Als Ennio Morricone am 6. Juli 2020 im Alter von 91 Jahren diese Welt verließ, ging nicht nur ein bekannter Filmkomponist von uns, sondern auch ein musikalisches Genie. Ein wahrhaftiger Meister vieler Fächer, von Arrangements bis Kompositionen, von Harmonien bis Soundexperimenten. Die meisten verbinden mit ihm Filmmusik, vor allem Italo-Western. Gewiss, mit diesem Sub-Genre konnte er sich erstmals innerhalb der Industrie der bewegten Bilder einen Namen machen, doch wie Regisseur und Oscar-Preisträger Giuseppe Tornatore (Die Legende vom Ozeanpianisten) in seiner Doku Ennio Morricone - Der Maestro sehr eindeutig zeigt und beweist, ist Morricone eben nicht nur Pfeifen, Mundharmonika und E-Gitarre. Er war ein echter Meister und nach dem Film sollte daran niemand mehr einen Zweifel haben.
Giuseppe Tornatore, für den der legendäre Komponist die Musik seiner cineastischen Liebeserklärung Cinema Paradiso beisteuerte, ist spürbar bemüht, die Ikone mit der dick gerahmten Brille ohne Wenn und Aber im Spotlight stehenzulassen. Zum Glück für uns führten die beiden noch ein langes Interview, welches nun die Aorta dieser Dokumentation ist, in der selbstverständlich auch dutzende andere bekannte Filmschaffende und Musiker zu Wort kommen (alleine diese hier aufzulisten würde diese Kritik sprengen), in der aber Ennio Morricone am meisten zu sagen hat. Es geht ja immerhin um sein Leben. Es ist die größte Stärke, dass es eben nicht irgendwelche Talking Heads sind, die über den Italiener reden, philosophieren, sondern dass es er selbst ist, der das Publikum mit auf eine Reise durch sein Leben nimmt.
Abgesehen von einer kurzen Sequenz, in der der Maestro, der ohne Instrumente komponierte, in seinem prall gefüllten Arbeitszimmer ein unsichtbares Orchester dirigiert, bietet die Doku inszenatorisch nicht mehr als gute Hausmannskost. Archivaufnahmen, Szenen alter Filme, ein Statement von einer Person, ein Statement von einer anderen und davor, dazwischen und danach ganz viel Morricone selbst. Keine schlechte Rezeptur, aber durchgehend mitreißend ist das nicht, weil es sich dann doch zu sehr in ein Korsett einengt und einige Male die Größe von wichtigen Teilen (davon gibt es verdammt viele) Morricones Schaffen auf eins, zwei Sätze herunter gedämpft wird, um Platz zu machen für andere. Das ist aber Meckern auf hohem Niveau und es lässt sich nicht bestreiten, dass es dem Film immer mal wieder gut gelingt, aus der Legende einen Menschen zu machen.
Wenn Morricone z. B. über seinen Mentor, den klassischen Komponisten Goffredo Petrassi, erzählt, dann merkt man alleine an seiner Stimme, wie wichtig ihm dieser Mensch war und wie schwer es ihm fiel, dessen Respekt zu verdienen, denn Petrassi empfand Filmmusik nicht als richtige Kunst. Auch die diversen Momente, wenn er davon erzählt, wie ihm bekannte Regisseure versucht haben in seine Arbeit zu pfuschen, sind immer wieder so amüsant wie formend. Es sind diese persönlichen, offenen Momente, die Ennio Morricone - Der Maestro herausheben aus dem Dickicht standardisierter Dokumentationsbefindlichkeiten herausheben. Wer nach dem Kinobesuch nicht mindestens ein paar Stunden lang Morricone-Soundtracks hört, ist entweder absolut unverbesserlich oder einfach nur taub.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org