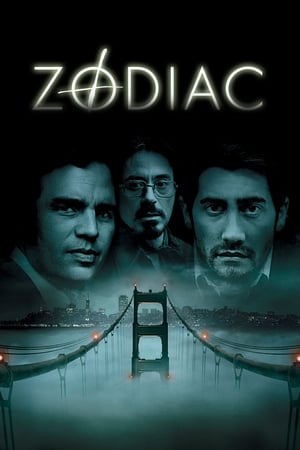Regungslos starrt J. Edgar Hoover auf den Fußboden seines geräumigen Büros, sein Blick ist fest auf einen bestimmten Punkt fixiert, doch dabei keinesfalls als leer oder gar verträumt zu bezeichnen. Hoover war kein Träumer. Beinahe 50 Jahre im Dienste des Staates stecken ihm bereits in den müden Knochen; er, der kleine Johnny aus Washington, der eigentlich Pastor werden wollte und sich dann doch fast ein halbes Jahrhundert als Chef des FBI an der Spitze der bürokratischen Nahrungskette Amerikas halten konnte. Nachgesagt wurde ihm viel, zu viel möchte man meinen, nicht zuletzt, dass er sogar der mächtigste Mann der Welt wäre, an dem sich sämtliche Präsidenten, und Hoover war ihnen allen ein Dorn im Auge, nichts anhaben konnten, egal wie missmutig sie an seinem Stuhl gerüttelt haben. Aber sein Leben, vor allem im Hinblick auf seine privaten Gepflogenheiten, war immer umklammert von Mythen, Gerüchten und Vorurteilen, gezeichnet von medialen, gesellschaftlichen und politischen Stigmata.
Wie also nähert man sich einer Persönlichkeit, die sich nie hat in Seele blicken lassen und doch einen so ungemein großen Einfluss auf die Staatsarbeit und deren Diener ausübte und selbst heute noch für massig Diskussionsstoff sorgt? Ohne Frage, Hoover war ein Mensch, der gleichermaßen geliebt wie verhasst wurde und sich mit derart vielen fachbezogenen Fehlern wie menschlich-ethischen Unstimmigkeiten durch sein Amt schlug, dass man ihm seinen Posten nicht einmal ein Jahr hätte anvertrauen sollen. Hoover war ein machtbesessener Konservativer, der nach außen hin mit seiner puritanische Ideologie hausieren ging und von jedem seiner Angestellten ein Maximum an Disziplin erwartete, in seinem stillen Kämmerlein aber fleißig Geheimakten anfertigte, um zu verhindern, dass ihm – welche seiner Kellerleichen auch immer aufgedeckt werden sollte – niemand von außerhalb an das Bein pinkeln konnte. Aber J.Edgars vordergründige Egomanie hatte mehrere Ziele.
Natürlich war Hoovers Arbeit beim FBI mit jeder Menge Obsessionen verbunden, er brauchte diesen Posten, musste sich auf Details und dabei in Unkosten stürzen, um seinen krampfhaften Perfektionismus zu frönen. Aber seine humorlose, vollkommen stringent wirkende Ich-Bezogenheit war auch eine Stütze dafür, die Kompetenzen und Wirksamkeit der Bundespolizei stetig zu erweitern und ihrer Effektivität im Umgang mit Beweisen, Chronologien und Tatbeständen auf den höchsten professionellen Stand zu hieven. Clint Eastwood weiß, dass dieses „Wie“ bei einer Biographie eine schwerwiegende Rolle spielt und das Ergebnis in der Vergangenheit gerne eine katastrophale Form angenommen hat. Deswegen wählt er zusammen mit dem hervorragenden Drehbuchautoren Dustin Lance Black den wohl besten Weg: Er greift markante Fakten und Anhaltspunkte in J.Edgars FBI-Vita auf, legt den Fokus aber nicht auf die sterile Abarbeitung dieser, sondern ist beinahe – nachdem alle Formalitäten geklärt wurden – durchgehend am Menschen hinter dieser mächtigen Fassade interessiert.
Und dieser Mensch, sein Innenleben, seine intimen Denkweisen und Ansichten, bleiben nun mal bis heute ein Geheimnis – genau wie der Inhalt seiner still und heimlich verfassten Geheimakten. Der elementare Punkt ist es da, das Skript nicht im Gossip-Schwurbel zu ersäufen; Plausibilität muss gerechtfertigt werden und der Person J.Edgar Hoover – auch wenn wir nie wissen werden, ob auch nur irgendetwas davon der Wahrheit entspricht – einen realitätsnahen Hintergrund und dem Biopic damit ein kraftvolles, weil glaubwürdiges Fundament zu verleihen. Und das gelingt dem Duo Eastwood und Black mit versierter Bravour – wenngleich man dem Endprodukt nun die gelegentlichen narrativen Durststrecken nicht gänzlich absprechen kann. Aber die werden im nächsten Augenblick wieder problemlos durch die hervorragende Performance von Leonardo DiCaprio wettgemacht, der hier nun endgültig (dieses Mal aber wirklich!) in den Schauspielolymp eingezogen ist.
Es ist nicht nur beeindruckend, dass sich Clint Eastwood – der ja nun auch nicht unbedingt als weltoffener Lebemann gilt – dem Privatleben von Hoover so urteilsfrei angenommen hat. Es begeistert auch gleichermaßen, wie subtil die Beziehung zwischen Hoover und seinem engsten Vertrauten Clyde Tolson (Armie Hammer) herausgearbeitet wird und „J.Edgar“ nicht zur Rekonstruktion einer staubiger FBI-Chronik macht, sondern vielmehr zur leisen Liebesgeschichte, in dem ein Mann Gefangener zweier Welt wird und sich der Homophobie seiner Mutter beugen, den stählernen Glanz des FBI repräsentieren und sich dabei auch noch gegen seine eigenen Gefühle stemmen muss. All das zu vereinen ist natürlich unmöglich, gerade seine Liebe zu Tolson verleiht ihm aber gerade einen zwischenmenschlichen Rückhalt, der Hoover vor der vollkommenen, inneren Einsamkeit und Depression gerettet hat. „J. Edgar“ ist erneut ein reifes Alterswerk Eastwoods, der mal wieder über den eigenen Tellerrand blickt und Hoover nicht nur als Monstrum, sondern auch als emotionalen Menschen zeigt, auch wenn er kein glücklicher war - Aber wer kann das schon von sich behaupten?
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org