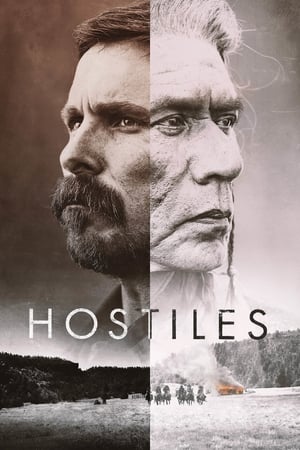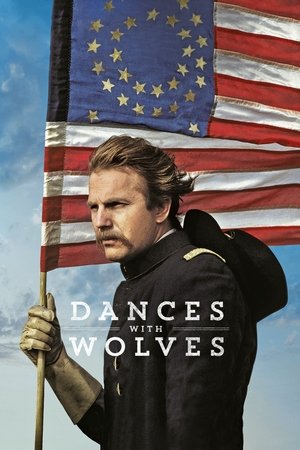„Wenn der Wind weht, weht er uns unsere Helden ins Gesicht. Unsere Diplomaten, Ärzte, Priester und unsere toten Kinder.“
Nachdem bereits Scott Cooper (Auge um Auge) in diesem Kinojahr mit dem großartigen Feinde – Hostiles in schonungsloser Taktung aufzeigte, dass die amerikanische Identität der Gegenwart dem Blut von Abermillionen abgeschlachteter Ureinwohnern entwachsen ist, knüpft Verräter wie wir-Regisseurin Susanna White mit dem ebenfalls überaus gelungenen und auf wahren Begebenheiten beruhenden Die Frau, die vorausgeht an diesen unangenehmen Themenkomplex an und macht sich auf, ein bitteres Hinterfragen von Gründermythen sowie dem Pioniergeist jener zeitgeschichtlichen Ära des ausklingenden Wilden Westens zu forcieren: Wie kann man mit Stolz erfüllter Brust auf die eigene Nation blicken, wenn diese doch im Endeffekt eine unrechtlich entwendete ist? Die Antwort darauf liefert auch Die Frau, die vorausgeht in eindeutiger Sprache: Gar nicht. Und alle Charaktere sind sich dieser Gegebenheit im Klaren.
Dreh- und Angelpunkt der im geschichtsträchtigen Jahre 1890 angesiedelten Geschichte ist Caroline Weldon (Jessica Chastain, Die Erfindung der Wahrheit), die sich nach dem Tod ihres Gatten aus dem fernen New York aufmacht, um ein Porträt von Indianerhäuptling Sitting Bull anzufertigen, nachdem sie sich in der freiheitlichen Erhabenheit der Gemälde von George Catlin verloren hat. Schon in der ersten Szene von Caroline verdeutlicht Die Frau, die vorausgeht durch das stramme Schnüren eines Korsetts, wie extrem die zukünftige Vertraute und Beraterin des reputablen Kriegers und Medizinmannes der Hunkpapa-Lakota-Sioux in patriarchalen Machtstrukturen gefangen ist. Weil es sich in jenen Tagen für eine Frau nicht anschickt, einer Arbeit nachzugehen, wurde die Porträtistin zur Hausfrau verdammt – und die Erlaubnis, in den Westen, geradewegs in ein Reservat, zu reisen, hätte sie zu Lebzeiten ihres Mannes ohnehin nie bekommen.
Die Frau, die vorausgeht erstrahlt in seiner bewussten Entschleunigung; in seiner bisweilen wunderbar kontemplativen Stille auch als zartgliedrige Emanzipationsgeschichte um eine Frau, die mit guten, aber auch von Naivität geschwängerten Absichten den Weg auf sich nahm, dem Mann gegenüberzutreten, der die Indianer am Little Big Horn zu ihrem größten Triumph führte, um alsbald mit ihren Aufgaben vor Ort zu wachsen, ja, dem Zusammensein mit Sitting Bull (Michael Greyeyes, The New World) auch ein politisches Ideal abzuringen, während sie sich dem brodelnden Hass der Siedler ausgesetzt sieht. Gemeinsam nämlich versuchen sie, gegen die weißen Kolonisatoren (u.a. gut besetzt mit dem für seine Rolle in Three BillboardsOutside Ebbing, Missouri frisch gebackenen Oscar-Gewinner Sam Rockwell als Colonel Silas Grove) vorzugehen und den hiesigen Ureinwohnern in North Dakota noch ein Stück territoriale Heimat zu überlassen, bevor ihnen alles entrissen wird, was rechtmäßig ihnen gehört.
Susanna Whites Regie überzeugt dabei nicht nur als feinfühlige, von Anfang bis Ende charaktergetriebene Studie über Menschen, die sich über kulturelle Gräben hinwegsetzen (oder an genau diesen Gräben scheitern), sondern auch als bedachter Befindlichkeitsfilm, der sowohl das Klima der historischen Epoche beschreibt, in dem den Indianerkriegen mit dem Massaker vom Wounded Knee ein zutiefst tragisches Ende gesetzt wurde, als auch die sanfte Annäherung zwischen Caroline und Sitting Bull mit der nötigen Ruhe und Konzentration nachzeichnet. Anstatt sich auf ausgetretenen Pfade zu begeben und ein amouröses Anbandeln zu bemühen, sorgen die famosen, zurückgenommenen agierenden Hauptdarsteller dafür, die Seelenverwandtschaft ohne klischierte Verzerrungen zum Knistern zu bringen. Mag Die Frau, die vorausgeht auch nicht die Mark und Bein durchdringende Treibkraft eines Feinde – Hostiles mitbringen, ist dieser Film doch nicht minder daran interessiert, der Wahrheit ins Auge zu blicken.
 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org