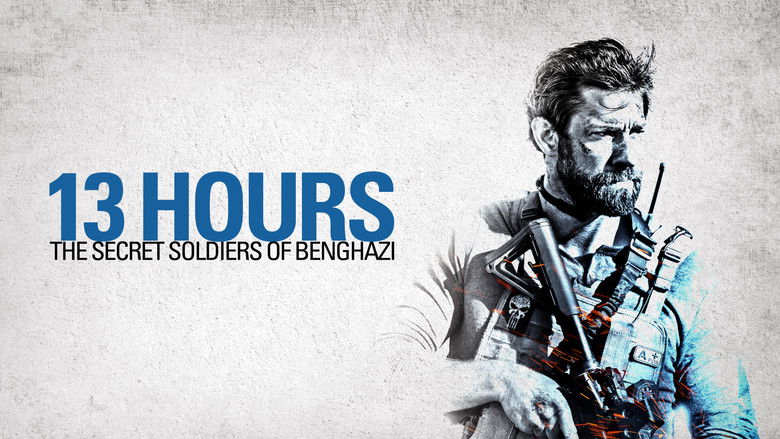Filmkritiker sind, entgegen der einhelligen Meinung, relativ gesellige Exemplare der Gattung Mensch. Nach einem Film bilden sich Grüppchen, es wird sich über den gesehenen Film ausgetauscht, Meinungen vorgetragen. Daraus kann Erkenntnisgewinn entstehen, da der eine auf andere Dinge achtet, als man selbst. Stellt euch vor, ein gutes Dutzend dieser Kritiker fahren nach „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“ im Fahrstuhl ins Parkhaus. Dicht an dicht stehen sie, der Moment der gemeinsamen Analyse ist gekommen. Doch das einzige, das anhält, ist das: Betretenes, unangenehmes, irritiertes Schweigen.
Denn „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“ ist fürchterlich. Auf jegliche Art und Weise. Regisseur Michael Bay fällt tiefer und tiefer, schlägt dem Fass den Boden aus und befindet sich immer noch im freien Fall. Wer noch Hoffnungen hatte, der Filmemacher würde sich auf seine Jubeljahre der 90er rückbesinnen, sei gewarnt. Was in der „Transformers“-Reihe noch halbwegs funktionierte – nämlich stilisierte Action in polierter Hochglanzoptik mit pathetischer Musik zu unterlegen – kehrt sich hier ins Gegenteil um. Die Geschichte rund um die Vorkommnisse in Bengasi verdienen eine filmische Nachbehandlung, keine Frage. Bay versucht sich als männliche Kathryn Bigelow, will ambitioniertes Politkino mit Soldatenfilm verbinden, doch was dabei herauskommt, ist lediglich ein „Transformers“-Klon.
Bumblebee und Optimus Prime heißen jetzt Jack und Tyrone. Für die gerechte Sache ballern sie sich durch halb Bengasi, bloß die Verwandlung in Autos, die haben sie noch nicht gelernt. Bays Verständnis von Politkino umfassen Explosionen und Zerstörungen wohin das Auge sieht. Verirrt sich doch ein kritischer Gedankengang in den Film, wird er sogleich durch unfassbar unpassende Oneliner und/oder pathetische Musik davongejagt. Man kann gar nicht so viel Popcorn in sich hineinstopfen, wie man kotzen möchte.
Es wäre alles nur halb so schlimm, wenn Bay ehrlich zu sich selbst und seinen Zuschauern wäre. Dann möchte er eben keinen anspruchsvollen Film a la „Zero Dark Thirty“ drehen. Er will Stereotype, Männerschweiß und Helden, die sich opfern. Alles kein Problem. Die Ereignisse von Bengasi dafür aber zu missbrauchen, heuchlerisch die Wahrheit in Stars and Stripes zu kleiden – das ist das wahre Verbrechen am Publikum. Die Elitetruppe ballert sich durch gesichtslose Libyer, zwei Stunden lang. Von Abnutzungserscheinungen seitens der Action muss an dieser Stelle kaum gesprochen werden. Wichtig ist Bay dabei nur eines: Coolness.
Die Optik des Films ist geleckt, Farbfilter verfremden die Wirklichkeit, ähnlich, wie es der gesamte Film tut. Selbst Ridley Scott wusste seine visuellen Einfälle in „Black Hawk Down“ der Dramatik des Films unterzuordnen. Bay gelingt nicht einmal das. „Explosions and stuff“ ist die Devise nach der in „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“ geschossen wird. Die leisen Momente, die der Film dringend benötigt, werden im schwülstigen Score förmlich ertränkt. Die undurchsichtigen Vorkommnisse in Libyen? Der kleine Fingernagel kratzt kurz an und selbst das wirkt höhnisch.
Das manifestiert sich am besten in den Figuren der libyschen Helfer auf Seiten der USA. Entweder sind sie Idioten, die dämliche Witze machen oder – wie im Falle des Übersetzers Amahi – sind sie versteckte Idioten, die erst im Laufe des Films der Lächerlichkeit preis gegeben werden. Gerade die Schicksale der Übersetzer, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familie aufs Spiel setzen, sind es wert, erzählt zu werden. Doch Bay fällt nicht mehr ein, als Amahi nach der Schlacht und einigen ekelhaften Gags nach Hause zu schicken. „Ihr müsst eure Probleme in den Griff kriegen, Mann!“, ruft ihm noch einer der Helden hinterher. Dass die Milizen einen Handlanger der Amerikaner wohl kaum frei laufen lässt, erwähnt niemand. Wer ist also der eigentliche Held?
„13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“ ist somit nicht nur verlogen, sondern durch und durch rassistisch. Seine vorgeschobene Art, nicht alles in Schwarz und Weiß zu zeichnen, macht ihn gefährlich und hassenswert. Da tun einem die durchaus talentierten Darsteller leid, die vor den Karren gespannt werden. Man fragt sich, ob Bay zu naiv ist um derartiges Kino zu produzieren oder ob es ihm einfach egal ist. Das kann nur jemandem gefallen, der während des Films den Kontext außer Acht lassen kann, beziehungsweise zu jung ist, um ihn zu begreifen. Oder man ist Amerikaner, masturbiert mit dem Gedanken an die amerikanische Flagge, summt beim Strullern „Star-Spangled Banner“ und zischt mit seinen Buddies abends ein paar Budweiser, während man sich der guten, alten Zeiten erinnert. Eine Zeit ohne Multikulti, wo alles einfach war und ein Mann mit sich und seiner Waffe im Reinen war. Für den Rest wartet das, was auch die Kritiker heimsuchte: Betretenes, unangenehmes, irritiertes Schweigen.