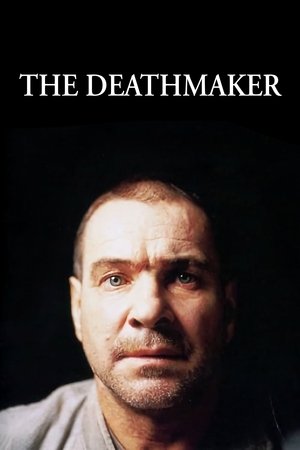Immer noch gilt „M – Eine Stadt sucht seinen Mörder“ - der erste Tonfilm von Fritz Lang („Metropolis“) – als einer der besten Filme aller Zeiten. In fast jeder aussagekräftigen Bestenliste, die je nach Herausgeber natürlicher, subjektiver Schwankungen unterliegt, führt ihn in vorderen Platzierungen, nicht ohne Grund. Unabhängig von seinem damaligen Status als ein technisch revolutionäres Werk für den deutschen Film lässt sich ihm unmöglich aberkennen, was er bis heute für eine enorme Relevanz hat, in praktisch allen Bereichen. Er unterstreicht beeindruckend den Stellenwert von Fritz Lang - der im Zwischenmenschlichen durchaus als schwierig, pedantisch bis despotisch bezeichnet wurde - als ein visionäres Genie seiner Zunft, als einen der prägensten, wichtigsten Filmschaffenden der Geschichte.
Beeinflusst von wahren Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte, insbesondere dem „Vampir von Düsseldorf“ Peter Kürten oder auch Fritz Haarmann aus Hannover (in der Eröffnungsszene des Films wird sogar der makabre Kinderreim zitiert, der auf seinen Taten beruht), erzählt „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ von einer grausamen Mordserie an Kindern, welche eben diese Stadt (offensichtlich Berlin, obwohl es nie konkret erwähnt wird) in Hysterie versetzt. Die Justiz ermittelt auf Hochtouren, lockt mit einer hohen Belohnung, scheucht die Unterwelt mit Razzien, Hausdurchsuchungen und (eher planlosen) Rasterfahndung auf. Die Bevölkerung ist übersensibilisiert, was zu Hexenjagd-ähnlichen Verhältnissen, gefährlichen Kurzschlussreaktionen und schizophrenen Selbstanzeigen führt, was die Arbeit der Polizei nur schadet statt nützt. Massenphänomene, wie sie sich (in abgeschwächter Form, auch aufgrund dezenterer, professionellerer Öffentlichkeitsarbeit) immer wiederholt haben. Denn seine inhaltliche Brisanz hat der Film in bald 90 Jahren kein Bisschen verloren, zeitlos-aktueller könnte ein Thema (traurig, aber wahr) kaum sein. Gerade das kann nicht jedes Werk von sich behaupten, das unvergessliche Finale noch gar nicht berücksichtigt.
Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Blick auf die Stilistik und dem Umgang von Fritz Lang mit den neuen Möglichkeiten des Mediums, denen er ursprünglich skeptisch gegenüberstand. Er befürchtete, dass der Tonfilm den Fokus weglenken könnte von der Bildsprache, der ästhetischen und narrativen Ausdruckskraft, durch die zuvor das nicht-gesprochene Wort aufgefangen werden musste. Lang wiederlegt dieses durch seine eigene Arbeit nicht nur (alles andere wäre ja auch absurd), er setzt die Technik dazu sehr gezielt, ausgewählt ein, vertont nicht jedes Detail und wählt sogar bewusst in einigen Szenen den „Rückschritt“ zur Stille, um den Auditiven einen höheren Wert und Effekt zu verleihen. Seine gewohnt exzellent arrangierten Bilder – eine Grundlage für die des späteren Film Noir – stehen der Innovation nicht hinten an. Die Symbiose aus beiden Elementen funktioniert nicht nur prächtig, sein Film gewinnt auf allen Ebenen dadurch. Es müssen keine Texttafeln mehr den erzählerischen Fluss leicht zerfleddern und die Darsteller können endlich auch mit ihrer Stimme arbeiten. In dem Zusammenhang fällt natürlich der starke Wien-Akzent von Peter Lorre („Der Mann, der zuviel wusste“) in der Ansammlung von Berliner Kodderschnauzen extrem auf, das mag unter Berücksichtigung seiner dargebotenen Leistung aber gerne verschmerzt werden.
Stichwort Peter Lorre: Was für eine Leistung. Aus heutiger Sicht könnte man ihm leichtes, mimisches Overacting vorwerfen, die markant hervorstechenden Froschaugen in Momenten der Panik haben einen leichten Slapstick-Charakter. Aber so wurde damals eben gearbeitet, wenn auf der Bühne oder in einem Stummfilm die Emotionen für jeden überdeutlich sichtbar gemacht werden mussten. Und selbst wenn nicht: Allein im letzten Akt ist er das (leicht, genau im richtigen Rahmen) ambivalente Gesicht von „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“, der als Gesellschaftsstudie und zeitloser, moralischer Diskurs noch interessanter ist als in der Rolle eines formell herausragend inszenierten Thrillers. Wenn nicht die hilflose, staatliche Gewalt, sondern das sich organisierende „Pack“ aus Verbrechern und Bettlern die Sache in die Hand nimmt (um des eigenen Burgfriedens willen), was seinen Höhepunkt in einem Scheinprozess findet, ist der Film endgültig bei einer Thematik angekommen, die sich so jederzeit und überall wiederholen kann. Weil die Antwort auf die gestellte Frage so unbefriedigend erscheint.
Wann ist ein Mensch für seine Taten – so unvorstellbar grausam sie sein mögen – vollständig zur Verantwortung zu ziehen? Sollten nicht alle Faktoren berücksichtigt werden, egal wie irrelevant sie für die Hinterbliebenen sein mögen? Und selbst wenn man zu einer eindeutigen Prognose kommen könnte, was wäre denn die Konsequenz? Auge um Auge klingt so leicht und auf eine primitive Art gerecht, mit Menschlichkeit hat das nichts zu tun. Opfer bleiben Opfer, nichts wird ungeschehen gemacht, was Fritz Lang mit seiner letzten Einstellung exakt ausformuliert. Er begeht vorher nicht den Fehler, seinen Mörder bis ins Letzte zu dämonisieren, noch sein Handeln zu entschuldigen. Er könnte einem fast leidtun, wie er um sein Leben fleht, sein Innenleben verzweifelt nach Außen kehrt, einen blutgierigen Lynch-Mob vor Augen. Wir haben ihn aber auch in seiner manchmal narzisstischen Grausamkeit erlebt. Spielt er nur die letzte, verbliebene Karte aus oder sehen wir wirklich einen kranken Mann, einen gefangenen seiner Zwänge? Letztlich wissen wir es nicht. Das sollte aber für ein Urteil keine Rolle spielen. Das unterscheidet den Mensch vom Tier…manchmal.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org