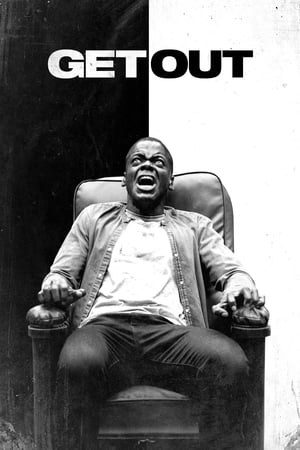Zwei Spielfilme der Amazon-Studios feierten beim Sundance Film Festival 2022 ihre Premiere, die in ihren Themen durchaus Überschneidungen aufweisen. Auf der einen Seite ist da Carey Williams’ Emergency, eine Komödie über zwei beste, schwarze Freunde, die, in ihrem letzten College-Jahr und eigentlich darauf aus, an einer Reihe von Partys während Spring Break teilzunehmen, in die missliche Lage geraten, eine betrunkene junge Frau in ihrem Haus aufzufinden. Aus Furcht vor dem Eindruck, der die Polizist*innen beim Anblick der kaum ansprechbaren jungen Frau im Kreis zweier schwarzer Männer fast unumgänglich zum vorschnellen Handeln treiben würde, versuchen sie in der Folge auf eigene Faust, die Unbekannte in Sicherheit zu bringen. Williams‘ Film erzählt davon, wie trotz all der gegebenen Informationen, trotz der Voraussicht, mit der seine Figuren die nächsten Minuten durchdenken, das finale Szenario nicht verhindert werden kann, wie der Abend, ganz wie ein Film-Plot, erwartungsgemäß seinem deprimierenden Endpunkt entgegenläuft.
Ganz ähnlich greift auch Mariama Diallo in ihrem Debüt Master, dem zweiten Spielfilm des Streaming-Services auf dem Sundance Film Festival 2022 die Black experience an einem Universitätscampus auf, wenngleich sie anderen diskursiven Abzweigungen folgt und ihre Geschichte im Gewand eines okkultistischen Horrorfilms präsentiert. Es sind insbesondere zwei schwarze Frauen, die uns zu Beginn durch Parallelmontage in neuen Positionen am elitären Ancaster College in New England vorgestellt werden. Mit großen Augen blickt first-year student Jasmine (Zoe Renee, Jinn) im Gewusel der Neuankömmlinge auf die Backsteingebäude des altehrwürdigen Campus‘, als ihr von einer älteren Kommilitonin ihr Zimmer zugewiesen wird, es sich nicht nehmen lassend, Jasmine vom Suizid zu berichten, den eine ehemalige Bewohnerin des Schlafzimmers einst begangen habe. Zur selben Zeit bezieht Gail Bishop (Regina Hall, Support the Girls), kürzlich zum „Master“ jenes Wohnheimes befördert worden, in das Jasmine nun einzieht, ihr neues Haus, dessen jahrelange Vernachlässigung sich trotz der eindrucksvollen Erscheinung in den Maden ausdrückt, die das Mobiliar infestieren. Dass auch ansonsten einige Jahre ins Land gezogen sein müssen, seit sich letztmals jemand längerfristig in den Gemäuern des Hauses aufgehalten hat, daran besteht angesichts der rassistischen Zeichnungen, die sie auf dem Dachboden auffindet, kein Zweifel. Explizit schwarze Gesichter sind es dort, deren Profile mit den animalischen Charakteristika von Primaten gleichgesetzt werden.
Effektiver noch als Emergency gelingt es Diallo mit Master, eine grundsätzliche Atmosphäre der Unheimlichkeit und Unsicherheit zu erzeugen. Realität, so lernen wir früh, ist allem voran Wahrnehmung, und Diallo ist bis zum Ende der 90-minütigen Laufzeit zu keinem Zeitpunkt daran gelegen, es uns in der Bequemlichkeit einer objektiven Wahrnehmung einzurichten. Wahrnehmung, das bedeutet Fragilität, die Möglichkeit der Veränderlichkeit vom einen Moment auf den anderen. Jasmine etwa, in der wir lange Zeit die Protagonistin vermuten, bis sich Diallo hauptsächlich auf die titelgebende „Master“ fokussiert, führen Albträume und Somnambulismus des Nachts bisweilen auf unbewusste Wanderungen durch das Wohnheim, ohne sich in der Folge dieser Bewusstseinsebene zu erinnern. Sobald sie den bösen Träumen allerdings entkommen kann, stellt die selbstbewusste Ausnahmeschülerin unmissverständlich klar, dass sie den Konflikt nicht scheut, so sich dieser auftut. Folgerichtig macht sie gegenüber ihrer Professorin Liv Beckman (Amber Gray, The Underground Railroad) dann auch keinen Hehl daraus, den Auftrag, einen Essay zu Nathaniel Hawthornes The Scarlet Letter unter der Berücksichtigung der critical race theory zu verfassen, für unsinnig zu halten, schließlich spiele race in Hawthornes Roman keine Rolle. Als sie in der Folge ein "F" für eben jenen Essay erhält, zögert sie nicht lang und bringt ein Anfechtungsverfahren der Note auf die Wege.
Liv, auf der anderen Seite, kann ein solches Verfahren gegen sich überhaupt nicht gebrauchen, ist sie doch die aussichtsreichste Kandidatin auf tenure – eine verbeamtete Professor*innenstelle auf Lebenszeit, die alle Leerenden an US-Universitäten anstreben. Liv, das ist auch Gails engste Vertraute am Campus, neben ihr die einzige Person of Color an einem Campus, der wie viele Universitäten dieser Tage Probleme damit hat, den im Lehrplan proklamierten Willen zur Diversität auch in der Selektion des Kollegiums und der Studierendenschaft unter Beweis zu stellen. Auf durchaus clevere Weise verschränkt Diallo das Schicksal ihrer drei im Mittelpunkt stehenden Frauen und spielt mit unseren Sympathien für oder gegen jene, ganz abhängig davon, in welchem Kontext sich diese gerade befinden, sei es in ihrer direkten Gegenüberstellung oder auf sich allein gestellt auf dem beinah gänzlich weißen Campus. Inmitten einer solch homogenen Gruppe, die allein durch ihre Präsenz auf beunruhigende Weise Normativität vorzugeben scheint, werden wir immer wieder Zeuge dessen, wie insbesondere Gail und Jasmine Momente der Entfremdung erleben, die Leichtigkeit und Amüsement binnen kürzester Zeit in ein Gefühl des Terrors umschlagen lassen. So etwa, als Jasmines Bett ungefragt für ein THC-lastiges Hang-Out von den Freund*innen ihrer Bettnachbarin in Beschlag genommen wird und einer der Jungen ihr, statt einer Grußformel, halbfragend, die Namen schwarzer Ikoninnen entgegenwirft: Beyoncé? Nicki Minaj? Serena Williams? Den Moment der Irritation überspielt sie fast unmerklich, doch es braucht nicht viel, um sich vorzustellen, dass die Souveränität, mit der sie die Bemerkungen von sich abschüttelt, um im nächsten Moment auf ganz selbstverständliche Weise den ihr dargebotenen Joint entgegenzunehmen, eine antrainierte ist, das Resultat unzähliger solcher Momente.
Wenig später allerdings gerät auch Jasmine aus der Fassung, als sie sich auf einer Party einen Augenblick lang ganz der Musik hingibt. Für einen Moment ausgelassen zu den Sounds von R&B und Hip Hop tanzend, geraten ihre Bewegungen jäh ins Stocken, als sie sich in einer Gruppe durchweg weißer, grölender Jungs wiederfindet, deren Gesichter sich auf beinah surreale Weise zu frenetischen Fratzen kultureller Aneignung verzerren. Das Gefühl der Sicherheit, das Master Gail ihren Studierenden zu Beginn des Semesters versprach, das Gefühl, dass diese in Ancaster nun bis an ihr Lebensende ein Stück Heimat finden würden, will sich für Jasmine nicht erfüllen, so sehr sich Gail auch darum bemüht, diese zu unterstützen.
Unterdes tritt auch die Kandidatur Livs für die Tenure-Professur in ihre heiße Phase, und als habe sich Diallo nicht schon genug darum bemüht, ihren Horrorfilm mit anschlussfähigen Diskursangeboten zu versehen, zentriert sie im letzten Drittel eine weitere Frage, die die Annahme von Wahrnehmung als entscheidenden Faktor der Realitätsbewältigung in eine gänzlich andere Richtung lenkt. Denn als Gail beginnt, an der Ethnizität ihrer Freundin Liv zu zweifeln, deren potenzielle langfristige Anstellung als Professorin zu nicht unwesentlichen Teilen mit ihrem ethnokulturellen Hintergrund zusammenfällt, stellt uns Diallo vor ein Dilemma unauflöslicher Komplexität. Was genau ist ein solcher ethnokultureller Hintergrund? Wer darf diesen geltend machen und wer nicht? Und verändert sich unser Urteil als Zuschauer*innen über Liv und ihre Identität dadurch, dass uns Regisseurin Diallo im Laufe des Filmes gegen diese aufbringt? Es ist eine unmöglich vertrackte Position, in die uns Diallo hier befördert. Im Gegensatz zu so vielen Horrorfilmen dieser Tage, die, häufig mehr aus Konvention oder Bringschuld denn aus Ambition, Ambiguität vorgeben, lädt Master wirklich zum Diskurs ein, dem wir uns alle stellen sollten.