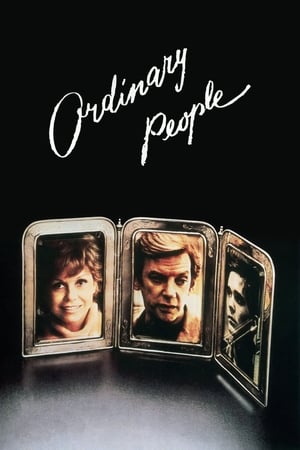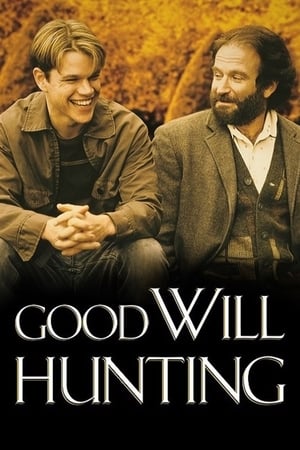"A little advice about feelings kiddo; don't expect it always to tickle."
Was muss der 31. März 1981 für eine (Oscar-)Nacht für Robert Redford (Die drei Tage des Condor) gewesen sein, als sein Familien-Drama Eine ganz normale Familie das Rennen um den Besten Film und die Beste Regie für sich entscheiden konnte und damit die klaren Favoriten wie Der Elefantenmensch von David Lynch, Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese und Tess von Roman Polanski aus dem Hintergrund regelrecht niederrang. Tatsächlich hat es das Regiedebüt von Robert Redford im Anschluss dieser Ehrerweisung jedoch nie vollbracht, als großer Klassiker in das kollektive Bewusstsein einzukehren - ganz im Gegensatz zu jenen Werken, die sich nicht über den Gewinn derlei hochdekorierter Auszeichnungen freuen durften. Höchste Zeit also, Eine ganz normale Familie aus seinem Schattendasein zu befreien.
Ja, es mag sein, dass Eine ganz normale Familie nicht mit der intensiven Strahlkraft eines Der Elefantenmensch oder Wie ein wilder Stier mithalten kann, trotzdem lohnt es sich über alle Maßen, diese beinahe in Vergessenheit geratene Perle des 1980er Jahre Kinos wiederzuentdecken, begründet Robert Redford hier doch seinen Ruf als feinfühliger, aufmerksamer Beobachter und entspinnt ein innerfamiliäres Geflecht, in dem es vor Gemütsbaustellen nur so wimmelt, niemand aber den Mut besitzt, diese offen anzusprechen. Dabei scheint auf den ersten Blick die heile Welt existent zu sein, die das archetypische Setting verspricht: Eine All-American-Family steht dort im Zentrum, der gehobene Mittelstand verspricht ein gesichertes Einkommen, das weitläufige Anwesen genießt seine Funktion als Statussymbol und Sohnemann Conrad (Oscar-prämiert: Timothy Hutton, Der Ghostwriter) glänzt durch seine Leistungen in der Schulschwimmmannschaft.
Der Schein aber trügt, wie die Alpträume, die Conrad schweißgebadet aus dem Schlaf reißen, schnell anklingen lassen. Wie eine grollende Schlechtwetterfront hat sich ein Schicksalsschlag über das Familienkonstrukt gelegt - die seelische Zerrüttung innerhalb dieses Gefüges jedenfalls ist oftmals von greifbarer Ausprägung. Niemand, vor allem Mutter Beth (Mary Tyler Moore, Keys to Tulsa), aber möchte das Prestige des Familiennamens in Gefahr bringen. Die eigene Wahrnehmung des Umfelds genießt Vorrang. Auch Vater Calvis (Donald Sutherland, Wenn die Gondeln Trauer tragen) scheint zu sehr damit beschäftigt, eigene Kämpfe, nämlich sein Scheitern an den Erwartungen, die dem Posten des Familienoberhaupts eingeschrieben scheinen, auszufechten. Die bürgerlichen Schalen dürfen nicht von Rissen gezeichnet werden, denn was sollen die Leute denken, wenn sie in Erfahrung bringen, dass Conrad psychologische Hilfe in Anspruch nimmt?
Eine ganz normale Familie beweist sich als ein Film, der von besonderer emotionaler Intelligenz geschrieben und inszeniert ist. Die zerfahrene, nahezu auf Eis gelegte Kommunikation, die Conrad in Bezug auf seine Mutter zusehends zu schaffen macht, ist nur die erste Stufe einer Wendeltreppe unausgesprochener Konflikte. Robert Redford verliert sich indes, bis auf punktuelle Ausnahmen, niemals im melodramatischen Geschwurbel, das diesem emotionalen Scherbenhaufen angedeiht werden lassen könnte. Stattdessen widmet er sich konzentriert dem Befinden der Menschen, die sich längst schon in ihrem eigenen Schmerz verkapselt haben. Schuldgefühle, die Unfähigkeit, einem geliebten Menschen Nähe zu zeigen und Trauerbewältigung bilden das stoffliche Topoi des intimen, ja, gar zurückgenommenen Dramas. Es geht hier letztlich nicht nur um Probleme, sondern auch um deren Lösungen und das Ausdeuten, dass Hilflosigkeit im Angesicht der Trauer absolut der Normalität entspricht.
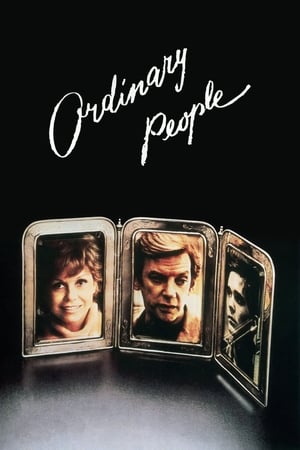 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org