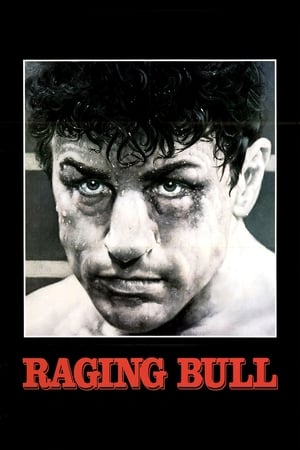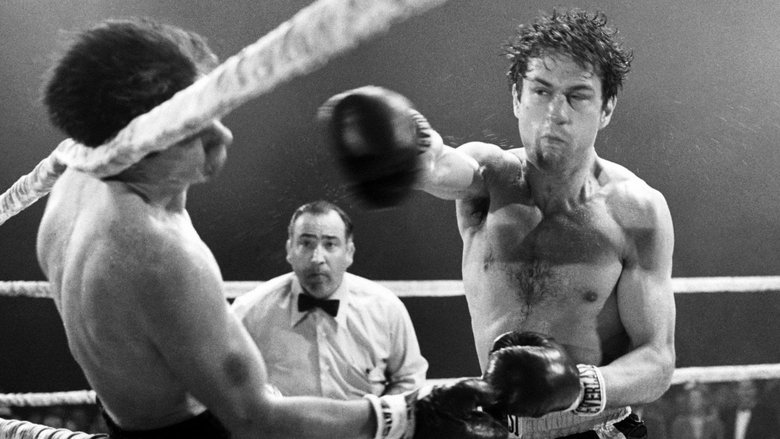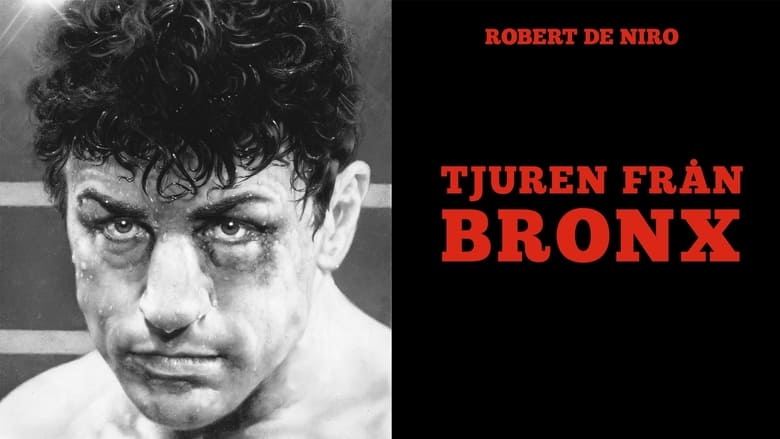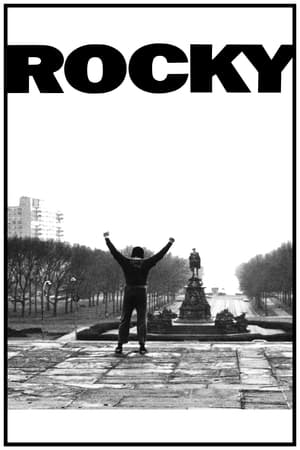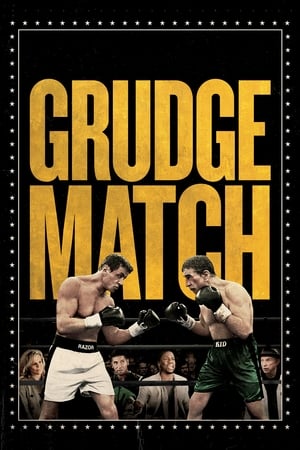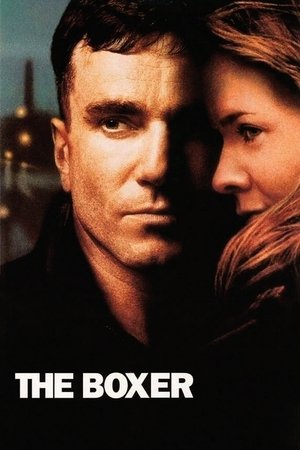Jack La Motta (Robert De Niro, „Die durch die Hölle gehen“) ist einer dieser Menschen, die nicht mit Kritik an ihrer Person umgehen können. Er kann es einfach nicht akzeptieren, wenn er in irgendeiner Art und Weise von seiner Umwelt infrage gestellt wird, wenn er nicht von den Menschen gefürchtet und geachtet wird, weil er einfach nicht in der Lage ist, sein eigenes Verhalten zu kontrollieren, weil er unfähig zur Selbstreflexion ist. La Motta ist ein Tier, ein in seinem Vorgehen auf den animalischen Urinstinkt reduziert und davon komplett dirigiertes Monstrum, welches nur den direkten, den explosiven Weg kennt. Er lässt sich von Misstrauen, Tyrannei, Eifersucht und blankem Zorn leiten, doch all das ist es auch, was ihn verlernen lässt, was leben wirklich bedeutet. Die Folgen sind absehbar, denn ein Mensch, der keinerlei zwischenmenschliche Werte schätzen kann, für den Dankbarkeit, Zärtlichkeit und Nächstenliebe Fremdworte sind, endet nun mal wie ein Versager in der Einsamkeit. La Motta gewinnt den Titel, doch er verliert all das, was seinem Leben einen wirklichen Sinn geben hätte können.
Martin Scorsese („The Wolf of Wall Street“) dokumentiert das Milieu, in dem Jack La Motta aufwächst, durch ungemein persönliche Erfahrungen, denn wie auch der Weltmeister im Mittelgewicht, entsprang die lebende Filmlegende ebenfalls der Gosse von Little Italy. Sein „Wie ein wilder Stier“ ist eine bleischwere, tiefgehende und in seiner präzisen Zielstrebigkeit beeindruckende Psycho- und Sozialstudie, die den Zuschauer in die schwarze Seele des Jack La Motta zieht. Sein Werdegang, gezeichnet von Überheblichkeit und Egoismus, ist ein langer, mühseliger Sturz in die Leere. Echte Größen wissen nach einem solchen herben Sturz wieder auf die Beine zu finden, La Motta aber bleibt zu Recht liegen, weil er seine Rechnung ohne die Ausmaße der Realität gemacht hat – Und die holen ihn schließlich ein. Es schmerzt dabei zuzusehen, wie Jack La Motta die Menschen verletzt, denen er wichtig war, wie er sein privates Umfeld eigenhändig zerbricht. Erst verlässt ihn sein Bruder, dann geht seine Frau Vickie, nachdem sie bereits unzählige Mal Opfer seiner Wutanfälle wurde.
La Motta meint zu wissen, in welche Richtung er sich bewegen muss: Immer nach vorne. Mit eiserner Faust, immer weiter nach vorne. Je weiter er sich hochkämpft, desto extremer steigt ihm der Ruhm zu Kopf, und doch ist es immer nur er selbst, der irgendeine Bedeutung für ihn hat. Hilfe hat ein Jack La Motta nicht nötig. Stimmt. Denn jede Hilfe würde an den scharfen Klippen seines Egomanie zerschellen. Zufriedenheit ist schließlich auch noch irgendwo vorhaben, nur tritt diese erst dann auf, wenn La Motta seine Gegner in ihrem eigenen Blut schwimmend auf dem Boden des Rings sieht. Das Gefühl der Unsterblichkeit, der Erhabenheit erwacht. „Wie ein wilder Stier“ offenbart eine Reise in die Selbstzerstörung, in die Selbstdemontage. Irgendwann, wie es nun mal jedem Sportler so ergeht, muss er darauf verzichten und einen neues Mittel finden, um sich in den Mittelpunkt zu drängen. Als fetter Nachtclubbesitzer ist La Motta längst eine gebrochene Persönlichkeit, doch Beistand oder Mitleid gibt es für ihn von keiner Seite. Sein größter Feind war es sich immer selbst und Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.
Was soll man von einem Menschen halten, der doch eine Vorbildsfunktion vertritt und die Rolle des familiären Alphatiers tragen sollte, diesen Dinge aber vehement abschwört und sich von der Verantwortung immerzu abkapselt? Wie soll man zu einem Menschen stehen, der Prügel wegsteckt wie kein zweiter, egal wie krachend die Fäuste in sein Gesicht donnern, La Motta bleibt stehen und schickt seinen Gegenspieler auf die Bretter, doch bei kleinsten Zwischentöne schon platzt? Soll man ihm als Sportler Anerkennung schenken? Soll man Anteilnahme an seinem Schicksal zeigen, weil er es eigentlich nicht besser gewusst hatte? Soll man La Motta verachten und verfluchen, weil er so ein widerwärtiges Ungetüm war? In jedem Fall sollte man Scorsese dankbar sein, dass er es dem Zuschauer ermöglicht, sich selbst eine Meinung zu bilden und der barbarischen Seele La Mottas letztendlich nicht einem Urteil unterziehen muss. „Wie ein wilder Stier“ ist schonungslos, aber das macht ihn ehrlich, und weil er Glorifizierungen und eine falsche Moralhaltung nicht nötig hat, ist er auch ein ebenso eindringliches Meisterwerk in jeder Hinsicht.
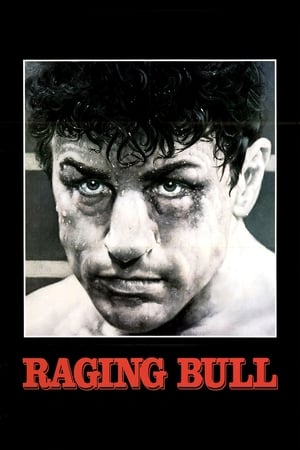 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org