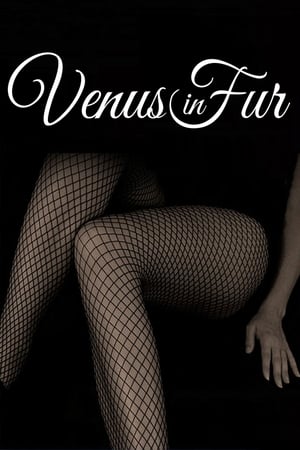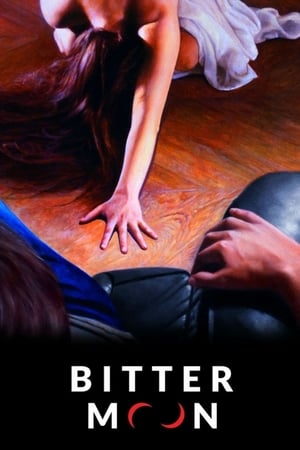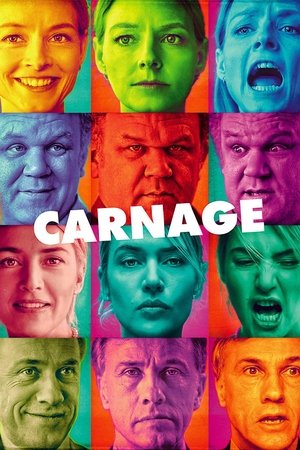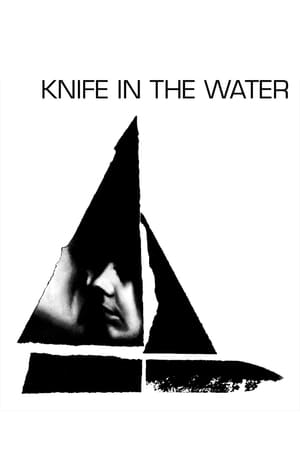Roman Polanski darf sich seit seinem gar wunderbaren Debüt „Das Messer im Wasser“ aus dem Jahre 1962 als unerlässlicher Bestandteil der Kinematographie zählen und konnte der Welt in den nun mehr als 50 darauffolgenden Jahren mit unzähligen weiteren Meisterwerken beglücken: Von „Rosemarys Baby“ über „Der Tod und das Mädchen“ bis hin zu „Der Pianist“. Einen Beweis seines Könnens ist der polnische Autorenfilmer niemandem mehr schuldig und auch die Befürchtung, Roman Polanski könne, ähnlich wie viele seiner einst mit einem so renommierten Ruf konnotierten Kollegen, der gefürchteten Altersmilde zum Opfer fallen, lassen sich anhand seines neusten Werkes „Venus im Pelz“ mit Leichtigkeit widerlegen. Der letzte echte Allrounder des internationalen Kinos nämlich hat es wieder einmal geschafft, mit minuziöser Präzision eine cineastische Punktlandung abzuliefern. Es stellt sich nun vielmehr die Frage, in welche Richtung es die Legende mit seinen 80 Jahren noch verschlagen mag, vor allem deshalb, weil er es Zeit seines Lebens tunlichst vermeiden wollte, mit einer klaren Stilrichtung in Verbindung gebracht zu werden und vehement die Diversität und Vielseitigkeit in Ehren hielt.
Wohin also führt der Weg des Roman Polanskis mit „Venus im Pelz“? Welche Themen scheinen für ihn heute noch von einer solchen Relevanz etikettiert, dass er sie auf der großen Leinwand thematisieren möchte? Die Antwort darauf lässt sich, ganz so wie wir es vom Altmeister inzwischen gewohnt sind und lieben gelernt haben, nicht mit einem flapsigen Satz abspeisen. Zuallererst muss man sich schließlich wieder ins Gedächtnis rufen, dass Polanski ohne Frage die künstlerische Flexibilität personifiziert, in seinen Werken aber immer einen Leitfaden durchschimmern lässt, der sich durch sein gesamtes Schaffen zieht und Polanski als Menschen – oder besser gesagt – Facetten seines Lebens behandelt und so seine Persönlichkeit definierten. Sein Hang zum Okkultismus ist kein Geheimnis und wurde mit „Die neun Pforten“ 1999 zum letzten Mal offensichtlich, mit seiner grauenhaften Zeit als jüdischer Junge im Holocaust von Krakau befasste sich Polanski in „Der Pianist“ und wurde weltweit zu Recht mit Preisen überhäuft und auch seine Hypersexualität, die er sich durch die erstrebte Kompensation des Verlusts seiner Frau Sharon Tate aneignete, fand in „Bitter Moon“ Ausdruck.
Es wird deutlich, dass, wenn man einen eigenen Film erstrebt, gezeichnet von individuellen Impressionen, von prägenden Lebenserfahrung und den analogen Höhen und Tiefen, bedeutet ein solches Unterfangen auch immer, dem Publikum einen Blick in das Innerste seiner selbst zu ermöglichen und diesem die Chance zu gewähren, für einen gewissen Zeitraum ein Teil dieses – eigentlich – vollkommen fremden Menschen zu werden und sich mit ihm zu beschäftigen. In „Venus in Pelz“ hingegen geht Polanski nicht nur allein auf sein wahres Ich ein, er rückt auch seine Person als Künstler, in dem er immer wieder Brücken zu anderen, eigenen Filmen schlägt, in das Geschehen ein, so subtil diese Referenzen auch sein mögen. Spannend ist es daher auch allein schon, die vielen Querverweise zu erkunden und nach eigenem Ermessen irgendwie zu deuten. Denn der plötzliche Umbruch in den deutschen Befehlston ist gewiss nicht nur deshalb getroffen, um dem Publikum einen Lacher zu entlocken, die erntet Polanski nämlich weitreichend in ganz anderen Momenten. Aber erst einmal zurück auf Anfang.
Nachdem Polanski mit „Gott des Gemetzels“ schon ein Bühnenstück, in diesem Fall von Yasmina Rieza, adaptierte und als burlesk-pointierten Geschlechterkampf auf die Leinwand projizierte, ist es nun erneut ein Kammerspiel, nach David Ives‘ Theatervorlage, welches dazu noch auf Leopold von Sacher-Masochs (Der Namensgeber des Sadomasochismus) berühmter, damals echauffiert verschriener Novelle basiert, mit dem der Meister den Zuschauer in seine Fänge lockt. Jetzt wird es knifflig: Mit „Venus im Pelz“ haben wir also einen Film, der in einer Theaterkulisse spielt, gleichzeitig auf einer Theatervorlage basiert, die daraufhin noch ihren inhaltlichen Ursprung in einer Skandalnovelle aus dem Jahre 1870 findet. Wem die Metaebenen nun schon zu dem Halse hängen, der hat sich noch nicht auf die Figurenkonstellation eingestellt, mit der Polanski durch den Film führt. Seine Ehefrau Emmanuelle Seigner möchte für die Rolle der Vanda vorsprechen, heißt im Film allerdings auch Vanda, und Mathieu Amalric, im Film verantwortlich für die Adaption des Stücks, ist Thomas, der vorerst widerwillig in die Rolle des Severin von Kusiemski schlüpfen muss.
Amalric, und das ist nun wirklich ein Wink mit dem Zaunpfahl, scheint dem jungen Polanski nicht umsonst wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie viel, und in ihm steckt reichlich, echter Polanski allerdings nun wirklich in Thomas stecken mag, kann letzten Endes wohl nur der Regisseur höchstpersönlich beantworten. Solch mannigfache Persönlichkeitsdimensionen benötigen Darsteller, die ganz in ihrer Wechselhaftigkeit erblühen und keiner Nuance in irgendeiner Weise gehemmt entgegenstehen – Und die hat Polanski mit der impulsiven Emmanuelle Seigner und dem versierten Mathieau Amalric zweifelsohne gefunden, die hier wirklich zu mimischen und gestischen Höchstleistungen auffahren, gerade in der konkreten Kontradiktion. Eigentlich war diese Vanda nämlich genau der Typ Frau, den Thomas rein gar nicht gebrauchen kann, mit ihrem saloppen Tonfall und dem – jedenfalls für Thomas – klaren Missverständnisses von Sacher-Masochs Vorlage: Sie erkennt darin einen sexistischen Sado-Maso-Porno, er eine wunderschöne Liebesgeschichte. Wer Recht in dieser Debatte behalten soll, tut nichts zur Sache. Wichtiger ist, wie Polanski den Sadomasochismus und die Begierde auf seine beiden Protagonisten überträgt und es dadurch nach und nach schafft, den Zuschauer selbst zum voyeuristischen Spielball des Geschehens zu machen.
„Venus im Pelz“ ist nicht humorbefreit, keineswegs, Polanski gibt dem Zuschauer immer wieder die Möglichkeit, sich lauthals über die das Szenario zu amüsieren, ohne seinen Figuren den Ernst abzuerkennen und ins Lächerliche zu ziehen. Die Dynamik innerhalb der Prä-Produktion aber ist zentrales Thema und das Ausloten von menschlicher Ambiguität mit dem der Regisseur sein Publikum so weit in die erotische Spannung und das verlangende Knistern auf der Bühne involviert, bis dieser sich wohl selbst irgendwann dazu bereit erklärt hätte, sich die Kleider extatisch vom Leibe zu reißen, um die fauchenden Peitschenhiebe repetitiv auf der nackten Haut zu erfahren. Ein stückweit selbstreflexiv ist die Demaskierung der sexuellen Unterdrückung seitens Thomas natürlich, und der sinnliche Schmerz, die demütigende Erregung, die sich auftuende sensitive Elektrizität, die den Theatersaal bis zum Zerbersten aufladen kann, all das ist Polanski nicht unbekannt. Die Handhabung dieser Aspekte ist schlichtweg brillant und das Wechselspiel der Machtverhältnisse im Zweifel von Schein und Sein, von reeller Bedürfnisfreilegung und imaginierter Dominanz ein so unterhaltsames, aber nie die eigenen Prinzipien verratendes Kammerspiel der ganz besonderen Sorte. Wer spielt hier überhaupt noch eine Rolle?
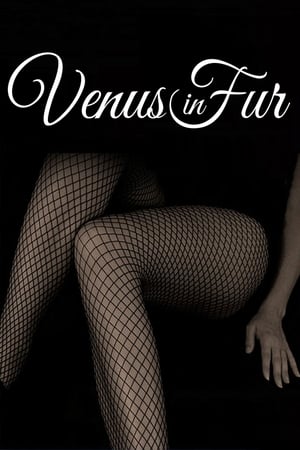 Trailer
Trailer