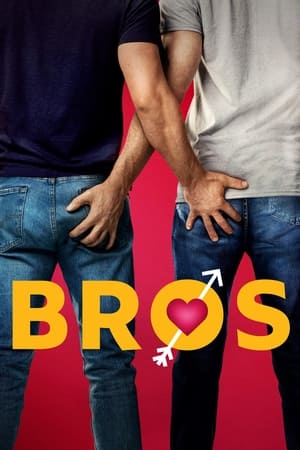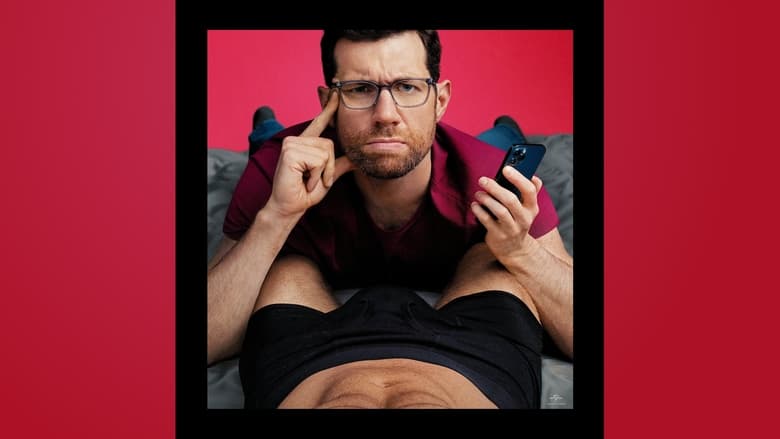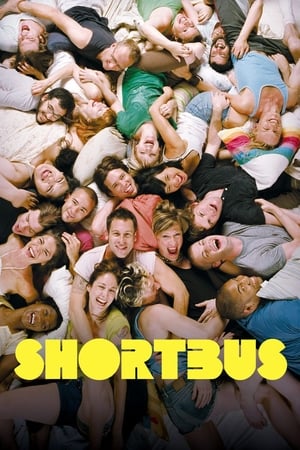In der deutschen Vermarktungsbranche war der Satz „Von den Machern von Jungfrau, (40), männlich, sucht… und Beim ersten Mal“ für eine ganze Weile der Stellvertreter für den Namen von Hollywoods langjährigen Komödienguru Judd Apatow. Die Filme aus Apatows Riege, für die er selbst mal als Regisseur, mal nur als Produzent und vereinzelt als Drehbuchautor fungierte, waren trotz (oder vielleicht gerade wegen) ihrer offensiven Zotigkeit reinste Status Quo-Befürworter, in denen ewige Kindsköpfe und verlorene, wie privilegierte, Großstadtkinder in oft improvisierten, überlangen Filmminuten sich selbst finden dürfen und zwischen Party- und Sexexzessen irgendwann „lernen, was wirklich wichtig ist“. Eine ganze Weile ging dieses Prinzip im Kino auf, aber im Jahr 2022, dem Zeitalter des Streaming, welches selbst jemanden wie Adam Sandler zu Netflix verschlagen hat, in dem fast alle Komödien aus den Lichtspielhäusern verschwunden sind und sich stattdessen im anonymen Äther des Netzes finden lassen, ist diese Party schon lange vorbei. Mit Bros, gedreht von Apatow Veteran Nicholas Stollar (Nie wieder Sex mit der Ex), schien sich nun der eventuelle Versuch eines Wiederauflebens dieser Ära anzukündigen. Die selbsternannte Sensation von Bros, die „erste, schwule Mainstreamkomödie“ zu sein, ist nicht nur unwahr und an den Haaren herbeigezogen, sie sollte auch als Umstand, anders als von Hauptdarsteller und Drehbuchautor Billy Eichner (Der König der Löwen) beschworen, nicht als verantwortlich für den finanziellen Misserfolg des Filmes an den amerikanischen Kinokassen gemacht werden, mit welchem jener Versuch leider jetzt schon gescheitert ist. Der Film erweist sich als gleichermaßen herzhafte, wie leider ernüchternde Fallstudie eines Publikums, das die Liebe zu dem allerseits beliebten Genre im Leinwandformat genauso verloren hat, wie scheinbar die kreativen Köpfe hinter ihnen.
Eichner spielt hier Bobby Lieber, einen erfolgreichen Podcaster, der zwischen oberflächlichen Preiszeremonien und anonymen Dating-Apps dem frivolen, schwulen New Yorker-Hedonismus frönt. Parallel ist Bobby als Kurator in der Kunstszene vertreten und steht kurz vor der Vollendung seines Herzensprojektes: Der Eröffnung eines exklusiven LGBTQ+ Museums, welches sich ausschließlich mit queerer Historie beschäftigen soll. In besagtem Museum soll nicht nur unter anderem Amy Schumer als Eleanore Roosevelt auftreten, es wird auch endlich die Homosexualität von Abraham Lincoln verhandelt und zusätzlich soll noch „Will & Grace“-Star Debra Messing natürlich auch eine Rolle spielen. Eigentlich verdient dieser Aufwand seine volle Aufmerksamkeit, doch leider verliebt sich Bobby, welcher von Monogamie und Bindung eigentlich gar nichts hält, ausgerechnet jetzt in den strammen Bodybuilder und unglücklichen Anwalt Aaron (Luke Macfarlane, Single All the Way). Trotz fundamentaler Unterschiede in ihrem Lebensvorstellungen sind beide bald unzertrennlich und müssen nun einen Balanceakt zwischen Intimität und persönlicher Wunscherfüllung vollführen. Innerhalb des filmischen Narratives bedeutet das übersetzt: Eichners Bobby behauptet, völlig zurecht, das der liberale Kühlschrankspruch „Love is Love is Love“ absoluter Schwachsinn ist und das queere Beziehungen sich maßgeblich von Heteroliebe unterscheiden. Eichner, der Drehbuchautor, handelt dem allerdings entgegen und zimmert die Beziehung zwischen Bobby und Aaron in ein klassisches „Will they, won’t they“. Das ist sehr abgegriffen aber an sich nicht verkehrt, besonders nicht wenn das unbeholfene Liebesspiel zwischen den beiden irgendwann in albern aggressive Machotriaden entgleitet und beide bald raufend am Boden liegen, eine Szene, welche herzlich das Element der in Bedrohung geratenen Maskulinität aus vielen Schwulenliebesfilmen parodiert. Leider aber stellt sich der, zumindest an Chemie zwischen den Hauptdarstellern nicht mangelnden, Beziehung bald die wahre Liebesgeschichte des Filmes in den Weg, nämlich die zwischen Eichner und dessen Ego.
Das der Film sich selbst als neu und nie dagewesen anpreist, aber eigentlich nur eine typische, an jeglichen Risiken kränkelnden Liebesgeschichte aus Hollywood erzählt, war ja zu erwarten. Wohl kaum etwas ist liberaler als performativer Fortschritt, der sich selbst auf die Schulter klopft. Auch das hier mit zwei gutaussehenden, weißen, schwulen Cis-Männern die wohl „sicherste“ Wahl für eine queere Komödie im Mainstream getroffen wurde war eigentlich von der Schmiede um Apatow, dessen Filme der 2000ern sich ebenfalls gerne als obszön und aneckend gaben, nur um am Ende relativ spießige Botschaften zu verkünden, abzusehen. Nicht überraschen tut auch die Tatsache, dass hier endlich wieder eine Komödie ins Kino kommt, die aber, anders hätte man es von dem Regisseur von Männertrip und Bad Neighbors wohl nicht erwartet, an filmischer Inszenierung leider auf absoluten Standardniveau bleibt. Was Bros aber am Ende versalzt ist das fade Gefühl, hier einer einzigen Selbstdarstellung Billy Eichners beizuwohnen. Eichners Bobby postuliert an einer Stelle, schon immer zu unangenehm für den heterosexuellen Mainstream gewesen zu sein und dass ein queeres Museum nun endlich seine persönliche Selbstverwirklichung mit sich bringen wird. In diesem Plot Aufhänger um jenes Museum entblößt sich leider wie massiv fehlgeleitet Eichners Ansatz ist: Das Museum als steriler, genormter Raum, in dem Heteropaare und -familien queere Kultur nähergebracht werden soll, kann man nur als einen gigantischen Assimilationsversuch begreifen, der queerer Kultur, die ja eigentlich den Status Quo herausfordern sollte, nur weiter in den Mainstream befördert. Dass der Film sich dieses Widerspruchs nicht bewusst ist, steht stellvertretend für Eichners ignoranten Ansatz, welcher sich nur die einfachsten Punchlines sucht. Als Beispiel: Für Bros besteht ein Aufreger darin, das queeres Kino nur aus Oscar-Bait wie The Power of the Dog oder Call Me By Your Name besteht, und zeigt sich damit völlig ignorant gegenüber zahlreichen Filmemachern wie John Waters oder Cheryl Dunye, welche selbst in diesem Film nur ein Schattendasein führen dürfen. Eigentlich ist dies nur konsequent, denn nur unter dieser Ignoranz kann sich Eichners Bobby und der Film selbst als die Wegbereiter hochfeiern, die sie nicht sind.
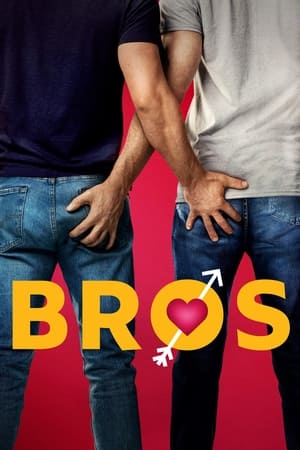 Quelle: themoviedb.org
Quelle: themoviedb.org