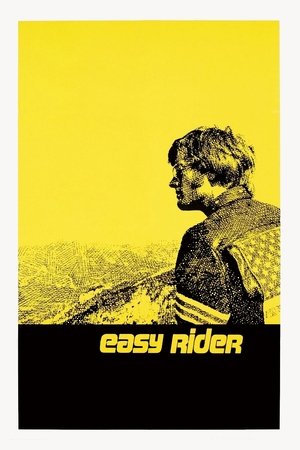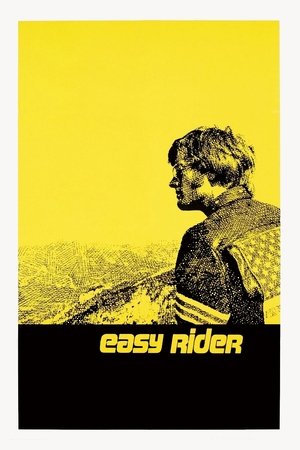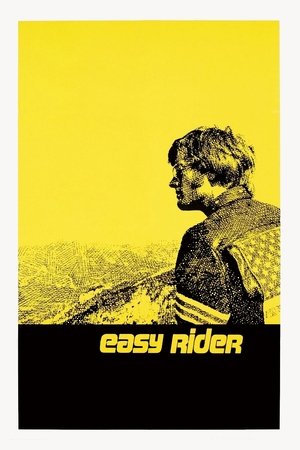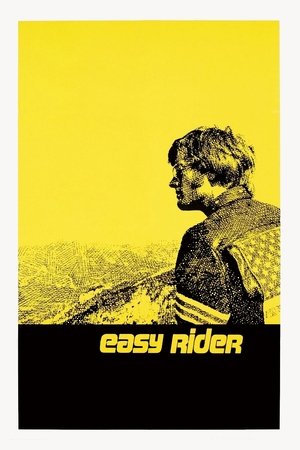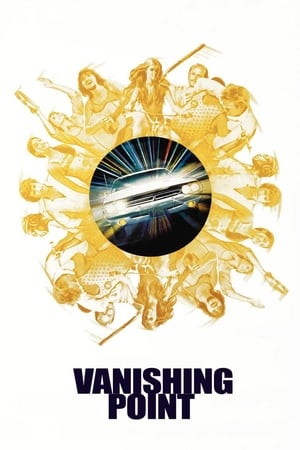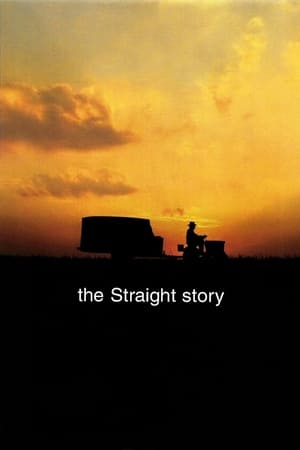-„They're not scared of you. They're scared of what you represent to 'em.“ „
-„Hey, man. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut.
-„Oh, no. What you represent to them is freedom.“
Vor heute drei Tagen, am 16. August 2019, erlag Peter Fonda im Alter von 79 Jahren den Folgen seines Lungenkrebsleidens. Praktisch während des 50jährigen Jubiläums des Woodstock-Festivals und nur gut einen Monat nach dem 50. Jahrestags des US-Kinostarts dieses Films, der ihn zu einer der ersten und wichtigsten Ikonen der New Hollywood-Welle werden ließ: Easy Rider, die Ode wie gleichzeitige Destruktion des amerikanischen Traums, der das Land of the Free als ein längst in verklärten Illusionen, diskriminierenden Hass und verlorenen Hoffnungen zersplitterten Scherbenhaufen darstellt. Ohne ihm seine natürliche Schönheit und den einst damit verbundenen Grundgedanken im Herzen absprechen zu wollen, aber selbst die größten Freiheitskämpfer können am Ende nicht die Augen vor der Realität verschließen. Und auch nicht vor ihrer eigenen, mit sich selbst nicht wirklich ehrlichen Rolle darin.
Mit der Kohle aus einem Koks-Deal wollen die Biker Wyatt (Peter Fonda, Jagdzeit) und Billy (Dennis Hopper, Blue Velvet, der hier gleichzeitig sein Regiedebüt ablieferte) ihren Trip zum Marti Gras nach New Orleans finanzieren. Auf dem Weg dahin legen sie unzählige Meilen auf ihren aufgemotzten Öfen zurück, rauchen Abend für Abend Gras am Lagerfeuer, gabeln einige Brüder im Geiste der friedlich-revolutionären 68er-Bewegung auf, führen mehr oder weniger tiefgründige Gespräche über augenscheinlich banale Dinge des aktuellen Zeitgeschehens (die aber genau deshalb so wahnsinnig viel über den Zustand einer Nation zum Ausdruck bringen) und begegnen immer wieder tiefster Ablehnung gegenüber ihres Lebensstils. All das mündet in einer nie wirklich als solche ausgelegter Sinnsuche und letztlich in einer fatalen Ereigniskette. Die nicht konsequent und unweigerlich ist, sondern im ersten Moment genauso willkürlich und tragisch-zufällig erscheint wie vieles in einem mehr oder weniger On-the-Fly gedrehten Film, der dennoch sein Anliegen mehr als eindringlich auf den Punkt bringt. Und darin erst offenbart, wie viel er über den Zustand eines Landes zu berichten hat. Aus dem Herz, dem Bauch und der Emotion heraus, ohne das ein durchkonstruierter Masterplan dem emotionale Fesseln anlegen kann.
Tatsächlich war das Projekt mehrfach zum Scheitern vorverurteilt, verweigerte sich der durchgehend zugedröhnte Dennis Hopper allen Zugeständnissen an konventionelles Filmemachen. Drehte wahnsinnig viel Material und erstellte experimentell-ausgedehnte Schnittfassungen, so dass der letztlich von anderen entschiedene Final-Cut ihm gar nicht wirklich zugestanden werden kann. Es ist fast nur ein Auszug aus dem ursprünglichen Sammelsurium, das vielleicht auch deshalb narrativ kaum der Rede wert ist und oberflächlich wirkt wie ein leicht dokumentarisch angehauchter Reisebericht zweier moderner, wortkarger Cowboys auf der Suche nach der Freiheit, das unterlegt mit Musik seiner Zeit und wunderschönen Landschaftsimpressionen fast wie ein ausgedehntes Musikvideo anmuten kann. Doch gerade durch seinen Verzicht auf einen raffinierten, wirklich durchdachten Plot verkörpert Easy Rider mehr intuitiv (aber am Ende spricht das ja eher sogar für ihn) ein Gefühl wie eine Bestandsaufnahme, die kaum authentischer und ungefilterter damals möglich gewesen wäre. Nicht umsonst ist das der erste, richtige Kickstarter des New Hollywood, denn niemals war ein Millionen-Dollar-Box-Office-Erfolg unberechenbarer, wilder und selbstentzündender.
So sehr Easy Rider der landschaftlichen Schönheit der USA wie auch seinem theoretisch immer propagierten Freiheitsdrang seine unbändige Liebe zollt, so sehr zerstört er den letzteren Gedanken Stück für Stück. Das „Captain America“ Wyatt – der die US-Flagge auf Bike, Jacke und Helm trägt, aber dennoch nicht ein Teil dieser Nation sein darf – und Billy von schäbigen Motels als Gäste abgelehnt werden, nehmen sie noch mit einem dezenten Fuck You hin. Bis irgendwann gesetzliche Willkür bis barbarische Selbstjustiz ihnen jede Hoffnung raubt. Auch weil zumindest einer von ihnen erkennen muss, das sie selbst nur einem nichtexistenten Goldtopf am Ende des Regenbogens hinterherjagen. Sie sich und ihren nie genau definierten, trotzdem als wichtig und vom Rest des verhassten Establishment abgrenzenden Idealen auch nicht gerecht werden können. Nicht so ehrlich gegenüberstehen, wie sie immer gedacht haben. Es ist das Leben eines ausgebrannten Traums, ein Weglaufen vor der Realität, nicht das Streben nach Freiheit und Autonomie. Sie könnten sie gar nicht packen, selbst wenn sie doch noch wie durch ein Wunder auf dem Silbertablett serviert werden würde. Eine Sackgasse auf dem Weg in ein vorher so euphorisch prophezeites Utopia.