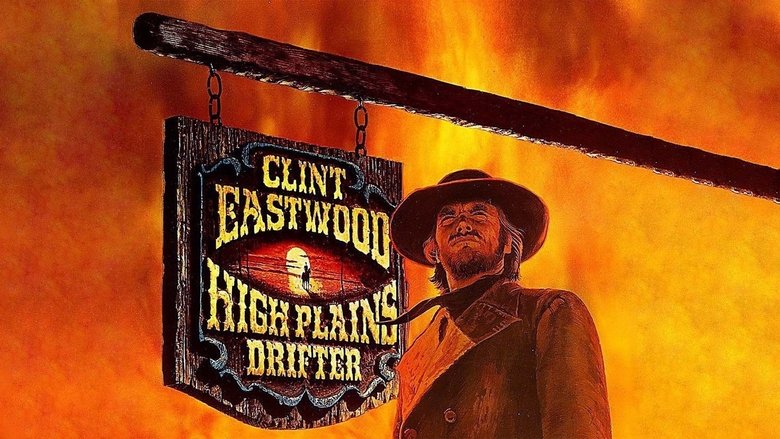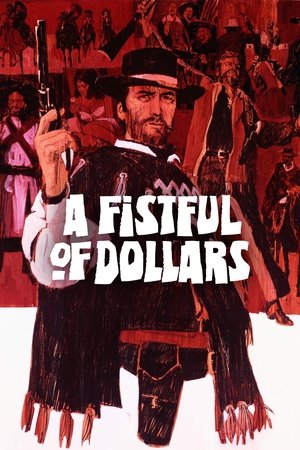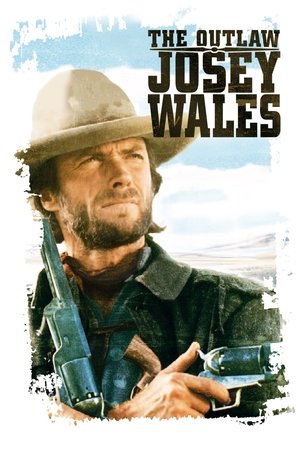1971 gab Clint Eastwood („Dirty Harry“) sein Regiedebüt mit dem Psychothriller „Sadistico – Wunschkonzert für einen Toten“, für seine zweite Arbeit kehrte er zurück zu den Wurzeln seines Durchbruchs und schwang sich natürlich höchst selbst wieder in den Sattel. „Ein Fremder ohne Namen“ scheint auf den ersten Blick ein Western zu sein, wie man ihn von und mit Eastwood kennt und erwartet, nichts Außergewöhnliches. Der deutsche Titel nimmt es bereits vorweg: Ein namenloser Fremder, stilecht unrasiert und Zigarillo-rauchend, kommt in das kleine Städtchen Lago eingeritten, von den Einheimischen missgünstig beäugt. Ungebetene Gäste scheinen hier nicht gern gesehen und werden automatisch als Bedrohung wahrgenommen, die oft beschriebene Gastfreundlichkeit des Wilden Westens, bei der sich die Frage stellt, wie sich der Ort überhaupt bevölkern konnte, außer die sind alle zusammen damals dort aufgeschlagen. Selbstredend dauert es nicht lange, bis „der Eindringling“ mit nicht mal einem Dutzend gesprochener Worte schon die ungeteilte Aufmerksamkeit der hiesigen Revolverhelden genießt, die kurz danach Geschichte sind. Natürlich ist der Reisende nicht wegen des warmen Ambientes und erst recht nicht ganz zufällig in Lago aufgeschlagen, es gilt eine offene Rechnung zu begleichen. So weit, so gut, so bekannt. Western as usual, doch „Ein Fremder ohne Namen“ entwickelt aus den gängigen Motiven seine ganz eigene Variante.
Zugegeben, es ist und bleibt oberflächlich die oft erzählte Geschichte von Vergeltung, Auge um Auge. Der wortkarge, mysteriöse Einzelgänger, den nichts und niemand aus der stoischen Ruhe reißen kann, seinen Widersachern haushoch überlegen scheint und sich dabei augenscheinlich nicht mal sonderlich anstrengen muss, von Eastwood in seinem gewohnt unantastbaren Brummbär-Modus routiniert runtergeknurrt. Doch schnell deutet sich schon an, dass bei „Ein Fremder ohne Namen“ gewisse Dinge anders sind und noch sein werden, als man von einem typischen (US)Western erwartet. Allein der bereits früh an den Tag gelegte Zynismus, sein pechschwarzer, lakonischer Sarkasmus und ein direkter, explizit-brutaler Härtegrat, den man so eigentlich nur von den europäischen Vertretern der Marke Sergio Corbucci („Leichen pflastern seinen Weg") und Konsorten kannte, lassen Eastwoods zweite Regiearbeit ungewohnt ruppig und radikal erscheinen. Mit den klassischen Western eines Howard Hawks („Rio Bravo“) oder John Ford („Der Mann, der Liberty Valance erschoß“) hat das hier Gebotene nur noch sehr wenig gemein, die Prägung seines Regisseurs durch die italienische Schule offenkundig. Man erkennt, dass es Eastwood daran gelegen war, der in die Jahre gekommenen und aus dem Rampenlicht verschwundenen heiligen Kuh der US-Filmindustrie einen neuen Input zu geben, sie durch die Erfolgsformel aus der alten Welt neu zu beleben. Was ihm gelingt. Anti wird bei Anti-Held hier riesengroß geschrieben, ehrbare Figuren im moralisch gerechten Duell zwischen Gut und Böse sucht man vergebens. Unrecht wird durch perfiden Sadismus vergolten, niemand einer gerechten Strafe übergeben, sie sollen leiden, im eigenen Saft schmoren und zur Hölle fahren.
Gemeint sind damit nicht nur die eigentlichen Mörder und Tyrannen, die den Fremden auf den Plan gerufen haben. Die - das sei ohne den Spaß an der Erstsichtung zu verderben erwähnt – werden als Sahnehäubchen für den Schluss aufgehoben. Zunächst sind die an der Reihe, die ihre Hände in Unschuld badeten, die passiven Zaunspatzen und Feiglinge, die nun in dem Fremden ihre letzte Bastion wägen und von ihm verspottet, gedemütigt und der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Mit welcher genüsslichen Spitzfindigkeit der Namenlose sein Spiel mit ihnen treibt, ist auf eine schadenfrohe Art herrlich mitanzusehen. Wie die Entenküken ihrer Mutter laufen sie dem letzten Hoffnungsträger hinterher, lecken ihm die Stiefel und bekommen bei jeder sich bietenden Gelegenheit von ihm den Spiegel vorgehalten. Sie sind Drückeberger, Duckmäuser, erbärmliche Waschlappen, die er herumschubst und verhöhnt. Dass er den kleinwüchsigen Wasserträger – bisher der Fußabtreter von Lago – in seiner ersten „Amtshandlung“ als inoffizieller Herrscher der Gemeinde zum neuen Sheriff ernennt und das nutzlose Weichei von Vorgänger entmachtet, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es folgen eine Reihe von Machtdemonstrationen, offenbar sinnlose Aufgaben und Forderungen werden gestellt, die allerdings einen Zweck verfolgen. Er will nicht nur den anrückenden Banditen einen gebührenden Empfang bereiten, bei der Gelegenheit werden alle zur Kasse gebeten. Rückwirkend betrachtet ein wahrlich bösartiges Skript, aus dem Eastwood formal einen großartigen Western kreiert.
Im Zuge dieser zügellosen Erniedrigung geht es allerdings einen deutlichen Schritt zu weit und drängt seinen Film in einem Punkt in eine extrem bedenkliche Ecke, die das Gesamtbild erheblich trübt. Das hier präsentierte Frauenbild ist nicht nur grenzwertig, es ist gelinde gesagt verwerflich, abwertend und im höchsten Maße – sagen wir, wie es ist – zum Kotzen. Praktisch im Vorbeigehen vergewaltigt Clint ein zickiges Weibsbild, weil sie es nicht besser verdient hat (das sie als Miststück skizziert wird, macht das natürlich kein Stück besser), macht sich sogar noch auf eine übel-verharmlosende Art über sie lustig, als ihr Versuch der Genugtuung scheitert (-„Können Sie mir sagen, warum die erst heute explodiert?“ – „Vielleicht, weil sie bis jetzt auf’ne Zugabe gehofft hat.“). Und dies bleibt nicht der einzige „Ausrutscher“ in diese Richtung. Es mag als Teil des Konzepts geplant sein, dass Eastwoods Rolle sich nimmt was er will - sogar die Frauen - und somit sein „Gastgeber“ als das ultimativ-rückratlose Gesindel entlarvt, die selbst das als notwendiges Übel akzeptieren, um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, dennoch geht das selbstverständlich gar nicht und ist nicht mal mehr als „unglücklich arrangiert“ zu bezeichnen. Besonders, da die Frauen dieses Unding sogar direkt ansprechen, am Ende aber doch dem raubeinigen Charme ihres Peinigers verfallen. Man muss keine Kampf-Emanze sein, um damit ein gehöriges Problem zu haben, völlig daneben so was.
So was kann einem Film sogar das Genick brechen, hier sorgt es für einen Eintrag ins Klassenbuch und eine punktuelle Abwertung, doch „leider“ ist der Rest so hervorragend geworden und dieser Aspekt nicht zentral genug für die Handlung und den Genuss des Films, dass man ihn mit einem unverständigen Kopfschütteln mal ausnahmsweise schluckt. Man könnte es auch beinah vergessen, wenn der Racheengel zu Tisch bittet, beim Picknick in der roten Hölle. Der Showdown ist sagenhaft, unterlegt von einem bald Genre-fremden, bizarren Score, ein brutales, skrupelloses Inferno, das erst die raffinierte Niederträchtigkeit der Story gänzlich offenbart. Ein denkwürdiges Finale, mit einer zur damaligen Zeit sicher verblüffenden, treffsicheren Pointe, die allerdings den Zuschauern der deutschen Synchronisation verwehrt bleibt. DVD und Blu-ray sei Dank, muss darauf auch hierzulande nicht mehr verzichtet werden, was sich seinerzeit mit dem heimischen Publikum erlaubt wurde, ist nichts Geringeres als eine bodenlose Frechheit. Wer ihn nicht sowieso im Original schaut, dem sollte dringend geraten werden, ungefähr drei Minuten vor Schluss einfach mal in den O-Ton zu wechseln, das reicht schon. Unglaublich, wie ein eigentlich banales Sätzchen wie „Yes, you do“ in dieser Form von „Übersetzung“ die Wirkung eines kompletten Films verändert und beinah zerstören kann. Was in der deutschen Fassung stattdessen gesagt wird, soll selbstverständlich nicht verraten werden, nur so viel: Es nimmt dem Film praktisch seine gesamte Intention, lässt einiges total sinnlos erscheinen bzw. beraubt ihm viel seiner Symbolik, die ihn erst so famos macht.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org