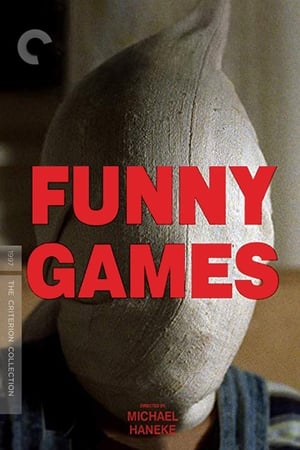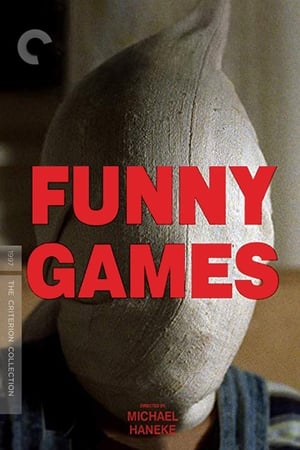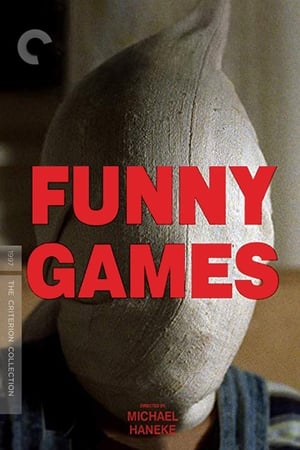Es gibt Filme, denen ihr Ruf vorauseilt. Michael Hanekes verblüffender Gewaltalptraum „Funny Games“ gehört ist einer dieser Filme. Er selbst sagt über den Film, er wünsche sich, dass keiner den Film zu sehen bekomme. Diejenigen, die den Film gesehen haben, schwanken zwischen beeindrucktem Lob und einem fast schon gehässigen Verriss mit dem Vorwurf, Haneke würde sein Publikum oberlehrerhaft bevormunden. Einig sind sich beide Parteien jedoch in der Hinsicht, dass der Prozess des Sehens von „Funny Games“ kein angenehmer ist. „Lustig“ ist an dem Streifen gar nichts und auch wenn alles nur ein Spiel ist (im Sinne von Spielfilm), so einfach wird man das Gesehene nicht abschütteln können. Dafür sorgt Haneke mit einer Inszenierung, die in ihrem Minimalismus unangenehmer nicht sein könnte.
Generell tun sich viele Menschen schwer, den Film richtig einzuordnen. Von Medienkritik über Gewaltstudie, von Drama über Horrorfilm bis Thriller hört und liest man immer wieder Versuche, den Film in eine Schublade zu stecken. Interessant ist, dass jede der genannten Kategorien überaus plausibel scheint. Der Film funktioniert als Genre-Beitrag, ist aber wohl unter der Oberfläche hauptsächlich als essayistische Auseinandersetzung mit Medium und Gesellschaft gemeint. Dass er dennoch als Genre-Beitrag funktioniert, liegt an dem Rahmen, den Haneke um die Kernhandlung legt. So beginnt der Film wie viele Horrrorfilme; die glückliche Familie fährt in die ländliche Idylle und gleichzeitig ins Verderben. Stanley Kubrick hat das in „The Shining“ gemacht, gefühlt jeder Backwood-Horrorfilm beginnt so. Und Haneke macht dies auch, jedoch auf seine ganz eigene Art und Weise.
Lockerleicht schwebt die Kamera über dem Auto der Kleinfamilie. Eine himmlisch gleitende Aufnahme aus der Sicht Gottes über seine Schöpfung. Ein Gott, an den in nur wenigen Minuten niemand mehr glauben wird. In dieser Autofahrt versucht das Ehepaar Opernsänger und Komponisten anhand von Liedern zu erraten - eine gebildete, leicht spießige Familie der Oberschicht frönt des Lebens und der Kultur. Sobald Haneke aber den Filmtitel einblendet, verstummt die klassische Musik für den Zuschauer, da er sofort mit vollkommen überzogener Punk-Screamo-Schrei-und-Grunz-Musik malträtiert wird. Genial ist, wie das Ehepaar dennoch in sinnlicher Ruhe im Auto sitzt - die Charaktere selber hören also noch ihre klassische Musik. Die beiden bekommen nichts davon mit, was um sie herum geschieht und schauen teilnahmslos auf die Straße. Haneke bringt hier bereits seinen Plan auf den Punkt; die Kleinfamilie bleibt regungslos ob der brutalen Chaotik - sie sind wie ein Publikum, das einen Film sieht und stumpf die abgebildete Gewalt verfolgt.
Alsbald macht der Österreicher sich in den nächsten Minuten daran, mit Genre-Elementen zu arbeiten, um die Charaktere und den bevorstehenden Konflikt aufzubauen. Da sind wir noch eine Weile von dem Durchbrechen der Vierten Wand entfernt. Da weiß der Zuschauer noch nichts von seinem Glück. Die Einführung der Bösewichte Paul und Peter (Arno Frisch, „Bennys Video“ und Frank Giering, „Absolute Giganten“) ist dabei ebenso einfach wie genial. In weiß gekleidet, brav und ruhig stehen sie da - die Typen von nebenan. Haneke filmt sie durch die Streben eines Tores oder ein Fliegengitter hindurch. Hier jedoch verweigert Haneke dem Zuschauer genretypische Vorgehensweisen und übertriebene inszenatorische Kniffe. Die Musik schwelt nicht in einem crescendo an, Close-Ups gibt es hier noch gar keine und keiner der beiden jungen Männer tut etwas, was man ihm übel anrechnen könnte. Einzig und allein das Vorwissen des Zuschauers sorgt dafür, dass Unbehagen sich breit macht.
Dieses Vorwissen ist es auch, was Haneke gekonnt nutzt, um mit ihm zu spielen. Die schematischen Andeutungen und Vorhersagen des Films funktionieren gut, insofern dass der Zuschauer sich immer wieder dabei erwischt, wie er sich gewissermaßen auf den Gewaltausbruch freut - so widerlich das auch klingen mag. Es verspricht nämlich Schauwerte, es verspricht Unterhaltung. Und das ist genau der Punkt, an dem Haneke ansetzt und den Zuschauer vollkommen auflaufen lässt. Der Konflikt wird nämlich konsequent aufgebaut, aber so undramatisch, dass man gar nicht klar festlegen kann, ab welchem Zeitpunkt die Situation richtig brenzlig wird. Irgendwie ist man auf einmal den beiden Männern ins Netz gegangen. Irgendwie sind einem auf einmal alle Fluchtwege abgeschnitten. Irgendwie möchte man sich auf einmal aus einer imaginären Schlinge befreien. Irgendwie lässt Haneke das nicht zu.
Der Horror beginnt derart unvermittelt und abseits des Bildes, dass man es vielleicht gar nicht wirklich mitbekommt. Die Stille, in der Haneke dem Zuschauer dann genüsslich eröffnet, was er grad verpasst hat, dass er blindlings in seine Falle getappt ist, wurde dem Filmemacher immer wieder als „hochnäsig“ angeheftet. Dieser Vorwurf greift vor allem in den Momenten, in denen Haneke den Paul die Vierte Wand durchbrechen lässt. Kühl, lakonisch, sadistisch gibt er sich dann und ganz so, als würde er mit uns - den Zuschauern - unter einer Decke stecken. Haneke lässt den Zuschauer für das haften, was Paul und Peter hier von der Leine lassen. Zumindest in der Hinsicht, dass der Zuschauer sich zunächst auf die Gewalt des Films freut, macht das Sinn. So ist „Funny Games“ hinreichend auch seiner Grausamkeit wegen bekannt, nicht unbedingt für die stilistischen Kniffe, die Haneke auffährt. Die Gewalt ist es, die das Publikum anzieht, ihre Abstinenz ist es, die es auflaufen lässt.
Interessant ist auch der Blick auf die andere Kehrseite der Medaille. Abseits der Genre-Muster und hin zu den medienreflexiven Überprüfungen von Gewaltpotenzial, -lust und -erfahrung des Films. Mag man zunächst noch vergebens nach glasklaren Elementen der Medienreflexion suchen (abgesehen von der eingangs erwähnten Titelsequenz), wird irgendwann deutlich, das Paul selbst das Medium darstellt. Er weiß um seine Wirkung, er weiß von dem Masochismus und dem Sadismus des Zuschauers, er achtet auf das Aussehen seiner Umwelt und spricht sogar über und für den Film selbst. Er verleiht dem Medium Gesicht und Gestalt und fordert den Zuschauer immer wieder provokant heraus. Ein Element, das jedoch fehlt, ist neben der Rolle des Mediums und des Zuschauers, die Rolle des Filmemachers selbst. Ohne Filmemacher gibt es auch keine Gewalt in Filmen. Haneke nimmt sich gewissermaßen selbst aus seiner Gleichung heraus und greift damit ein wenig zu kurz. Da wäre mehr tatsächlich mehr gewesen.
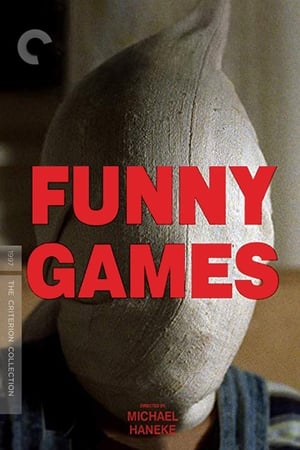 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org