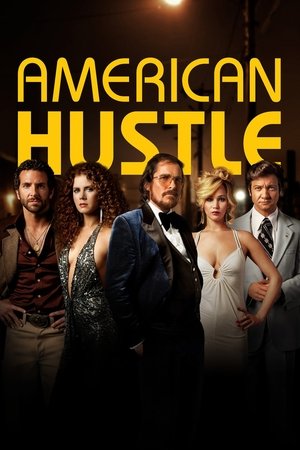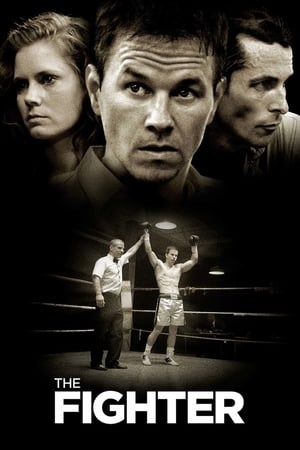Für einen Regisseur ist es mitunter gar nicht so einfach einen prägnanten Stil zu entwickeln, ohne dass diese Handschrift gleich als klischeehaft oder sogar störend veurteilt wird. Während beispielsweise Tarantinos Tendenz unchronologisch zu erzählen oder Dialoge auf eine bestimmte Weise zu gestalten von den meisten gefeiert wird, verschreien viele ein neues Tim Burton Projekt schon vorab als „eh immer das Gleiche“ oder halten bei einem JJ Abrams direkt Ausschau nach unnötigen lens-flares.
Bei David O. Russels neuestem Projekt „Joy“ halten sich die Stimmen noch sehr die Waage. Ja, der Film folgt in vielerlei Hinsicht der Schablone seiner Vorgänger: Er greift auf ein für ihn vertrautes Ensemble von Schauspielern zurück, er komponiert alles zu einem recht eigenen, relativ langsamen Pacing zusammen, der Soundtrack spielt eine enorme Rolle und die Kombination aus Handlung, Stil und Veröffentlichungsdatum machen den Film fast automatisch zu einem Oscar-Kandidaten. Aber nur weil einem bekannten Rezept gefolgt wird, bedeutet das ja noch lange nicht, dass das Gericht nicht schmeckt. Sehen wir uns also erstmal die Einzelzutaten an.
Der dramatische Aufbau ist sicher erstmal nicht jedermanns Sache. Das liegt vor allem daran, dass alle heiteren hoffnungsschimmernden upbeat Momente direkt wieder zerschlagen werden und das für eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn man hier den normalen Erzählrhythmus einer Erfolgsstory erwartet, empfindet man das vermutlich über einen Großteil des Films hinweg als frustrierend oder sogar deprimierend. Genau dieser Kunstgriff allerdings übermittelt die Botschaft des Films: Der Titelheldin Joy (Jennifer Lawrence) wird unglaublich lange kein Erfolg oder Zuspruch vergönnt; keine „jetzt läufts aber“-Phase um sie oder uns emotional zu stabilisieren und ihren Traum als greifbar erschienen zu lassen. Vielmehr muss sie sich wahnsinnig lange durch einen Hagelsturm von Rückschlägen und Entmutigungen durchkämpfen und sich dabei oft sehr weit aus dem Fenster lehnen. „Gib niemals auf!“, ist die Parole des Films.
An dieser Stelle sollte man auch direkt erwähnen, dass der Film eine Sache ganz exzellent macht und zwar die realistische Darstellung einer starken weiblichen Hauptrolle. Klar, gibt es das auch anderswo, aber viele Filme haben die Tendenz ihre Protagonistin entweder auf eine Art und Weise tough zu machen, die quasi vermännlichend ist, oder immer wieder ihre Situation als Frau extrem zu betonen, so als müsse man sagen „Ja, sie kriegt das auf die Reihe, obwohl sie ja eine Frau ist!“.
Hier wird jedoch einfach eine starke, intelligente Person auf dem beschwerlichen Weg zu ihrem Traum dargestellt. In dieser Einfachheit liegt dann aber auch ein Problem des Films. Die auf einer echten Person beruhende Joy Mangano gibt nämlich als Figur nicht besonders viel her. Auffällig wird das vor allem, weil sie über den gesamten Kurs des Films, wo wirklich alle anderen Figuren Gelegenheit bekommen mehr oder minder furchtbare Menschen zu sein, stets wie eine Heilige dargestellt wird. Dadurch fehlt der Geschichte das gewisse Etwas... nicht zuletzt richtige Glaubhaftigkeit, die ein Biopic immerhin haben sollte. Seltsamerweise gibt es sogar Szenen, die ein eventuelles moralisches Dilemma vorbereiten könnten, wozu es dann aber nie kommt. Das wirft ein bisschen die Frage auf, ob es da zu Kürzungen im Drehbuch oder Endschnitt gab, aber das ist natürlich reine Spekulation. Eine weitere Ungereimtheit liegt darin, warum der Film zumindest teilweise als „Komödie“ gelistet wird, denn trotz des einen oder anderen Moments am Anfang ist der Film beileibe nicht witzig. Böse Zungen behaupten, dies wäre vor allem geschehen um das Feld für Oscarnominierungen zu erweitern, da die Konkurrenz im Drama-Sektor für 2016 ziemlich stark sein dürfte...
Dankbarerweise liefert Jennifer Lawrence aber eine ziemlich starke Performance ab, die nicht nur ganz gut über solche Kleinigkeiten hinwegtäuscht, sondern den Film auch über weite Strecken trägt. Das ist wirklich sehr sehenswert. Wer nämlich dachte, Bradley Cooper und Robert De Niro wären als weitere große Nahmen eingebaute „Stützräder“, der irrt. Die beiden Nebendarsteller haben zwar ihre eigenen, ziemlich starken Szenen, aber die sind sehr vereinzelt und nur an bestimmten Ecken und Enden eines Films eingebaut, der den Großteil seines Rampenlichts zweifellos Frau Lawrence einräumt, was sie problemlos meistert.