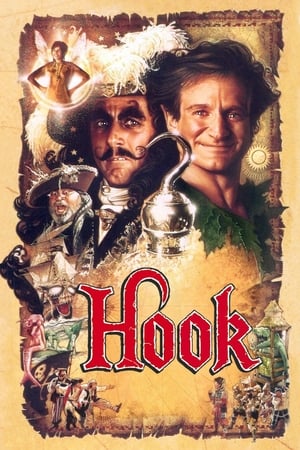Joe Wright ist ein Virtuose. Der britische Regisseur entwirft mit seinen Filmen jedes Mal aufs Neue ganz eigene Welten. Im Gegensatz zu anderen großen Regisseuren unserer Zeit wiederholt er sich dabei allerdings nicht. Während Nolan, Fincher oder Scott es sich in ihrer (stilestischen) Nische bequem gemacht haben, probiert Wright mit jedem neuen Projekt andere Stilmittel und –Kniffe aus. Mit „Abitte“ drehte er klassisches Gefühlskino mit sensationellen aber niemals prahlerischen Methoden (man denke nur an die grandiose One-Shot-Szene am Strand), in „Wer ist Hanna?“ mixte er pochende Beats mit Paranoia-Thriller, Coming-of-Age und den Symbolen teutonischer Dichtung und in „Anna Karenina“ machte er die Kinoleinwand kurzerhand zu einem Theater – Umbauten inklusive. Mag also sein, dass Wright nicht zu den bekanntesten Regisseuren der heutigen Zeit gehört, dafür ist er aber einer der einfallsreichsten und interessantesten.
Mit „Pan“ inszenierte Wright nun eine Art von Prequel der bekannten Geschichte rund um den Jungen der nicht älter werden will, fliegen kann und im zauberhaften Nimmerland zusammen mit seinem „Lost Boys“ gegen den hakenhändigen Piraten und passionierten Lügner Cpt. James Hook kämpft. Unzählige Versionen der Geschichte von Autor J.M. Barrie wurde bereits verfilmt. Im Drama „Wenn Träume fliegen lernen“ drehte es sich sogar ganz um die Entstehung der Figur Peter Pan.
Die Idee mit „Pan“ zu erzählen wie Peter Pan zum Anführer und Helden Nimmerlands wurde ist eine schöne, auch weil man sich hier als Geschichtenerzähler einigermaßen austoben und nicht nur den Mythos des fliegenden Junge erklären und frisch definieren kann. Joe Wright und sein Autor Jason Fuchs beginnen ihre Geschichte in London während der Hochphase des zweiten Weltkrieges. Das erinnert nicht von ungefähr an „Die Chroniken von Narnia“, mit dem graviernden Unterschied, dass „Pan“ wesentlich vitaler und ideenreicher wirkt als die recht mutlose sowie konservative Filmumsetzung des bekannten Fantasyromans von C.S. Lewis.
„Pan“ besitzt wirklich viele schöne Ideen. Es sind dabei nicht die großen die überzeugen, sondern die ganzen mannigfaltigen Details. Wright tobt sich hier ordentlich aus und drückt ganz nebenbei auch recht kräftig aufs Gaspedal. Hat man zusammen mit Peter diese Welt hinter sich gebracht und hat endlich Nimmerland erreicht hetzt und holpert „Pan“ regelrecht durch die Erzählung und die Ereignisse. Da kann man – trotz der Einfachheit der eigentlichen Geschichte – schon einmal den Überblick verlieren, aber genau das passt ganz wunderbar zum Film. Das Gleiche gilt übrigens auch für eine andere scheinbare Schwäche des Films.
Gemeint ist die künstlich wirkende Optik. „Pan“ ist, betrachtet man ihn grob und ohne sich die Mühe zu nehmen Schlüsse zu ziehen, ein waschechtes CGI-Monstrum. Vor allem Nimmerland erstrahlt im reinrassigen Look moderner Computertechnik. Hier scheint kaum etwas wirklich physisch zu existieren. In satten Farben und oft auch weichzeichnerischen Bildern überkommt einem als Zuschauer oftmals das Gefühl reinrassiger Künstlichkeit. Aber genau das passt ganz wunderbar zum Film. Joe Wright inszeniert Nimmerland wie einen Traum: Alles ist viel zu bunt, scheinbar zu unorganisiert und der pure Gigantismus kennt keinerlei Skrupel. Das besitzt etwas sehr Reizvolles, zerrt allerdings auch an den Kräften.
Man könnte „Pan“ ungefähr so beschreiben: James Cameron inszeniert ein Theaterstück für Kinder mit der Technik von „Avatar – Aufbruch nach Pandora“. Wobei „Pan“ dafür dann doch noch viel zu energetisch und eskapistisch ist, vor allem wenn es den Rausch der Bilder geht. Ein wenig erinnert der Film visuell an Ang Lees Meisterwerk „Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger“, wobei dieser klar und überdeutlich besser als „Pan“ ist, vor allem weil Lee die wunderschönen aber auch artifiziellen Bildermassen immer auch an die Gefühlswelt seinen Helden koppelt. Davon ist Wrights Fantasyfilm meilenweit entfernt.
Dafür besitzt er etwas anderes, etwas was gerade eben schon kurz angesprochen wurde: Eskapismus. Alles in „Pan“ ist darauf ausgelegt aus der schnöden Realität und unserem vorangestellten Wissen auszubrechen. Wir wissen wie Piraten sind? Ach ja, wirklich? Also in „Pan“ begrüßen die Seeräuber ihre Neuankömmlinge mit dem Nirvana-Song „Smells like Teen Spirit“ und gerne wird auch der „Blitzkrieg Bop“ der Ramones vorm Segelhissen geträllert. Das erinnert natürlich an die Filmsprache, bzw. -Welten des Australiers Baz Luhrmann, doch „Pan“ folgt diesem stilistischen Strang nur über kurze Strecken. Der Film braucht auch nicht unentwegt moderne Rock- und Popmusik, um ergötzende Anti-Konformität zu generieren, denn dafür hat der Film ja noch sein Ass im Ärmel und das ist Hugh Jackman.
Der ewige Wolverine spielt hier nicht bloß den Antagonisten Captain Blackbeard, nein, er verkörpert auch regelrecht den Trotz von „Pan“ sich der klassischen Zugehörigkeit des Stoffes zu unterwerfen. Noch nie sah man Jackman so herrlich ungezügelt, so frei und so wunderbar überzeichnet. Sein Blackbeard ist zeitgleich Schurkenparodie sowie sinisterer Gegenspieler. Ein teuflischer Bonvivant in dessen Verkörperung Jackman vollends erblüht und aufgeht. Alleine deswegen sollte sich ein Blick auf „Pan“ lohnen, auch wenn man klar sagen muss, dass die anderen Darsteller oft und gerne von Jackmans sowie der artifiziellen Schwere der traumhaften Nimmerlandbilder erdrückt werden. Dennoch sind auch die anderen Rollen gut besetzt und „Tron Legacy“-Star Garrett Hedlund darf sich hier als klassischer Heldentypus mit großem Mundwerk für weitere Abenteuer- und Actionfilme empfehlen.
Newcomer Levi Miller, der den Peter spielt und hier in seiner ersten großen Kinorolle zu sehen ist, erweist sich allerdings als Problem. Damit ist gar nicht mal sein Schauspiel gemeint, sondern mehr der charakterliche sowie narrative Umgang mit seiner Figur. Ist Miller zu Beginn noch als abenteuerlustiges Kind zu sehen, wandelt sich seine Rolle im Verlauf der Geschichte immer mehr, bis Peter Pan die scheinbar erwachsenste Figur in ganz Nimmerland ist. Das passt leider so gar nicht ins Konzept und wird der Legende auch keineswegs gerecht.
Gleiches gilt übrigens auch für die freundschaftliche Beziehung zwischen Peter und James Hook, vor allem weil der Film von Beginn an (und erst recht in seinen Werbekampagnen) damit prahlt, dass er erklärt wie es dazu kam, dass die beiden Freunde zu Todfeinden wurden. Was „Pan“ aber letztlich anbietet sind nicht mehr als Verweise auf die Zukunft der beiden. Den Mut einen dramatischen Bruch einzuleiten oder gar durchzuführen besitzt das Prequel leider nicht und bleibt seinem Publikum so durchaus etwas schuldig.
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org