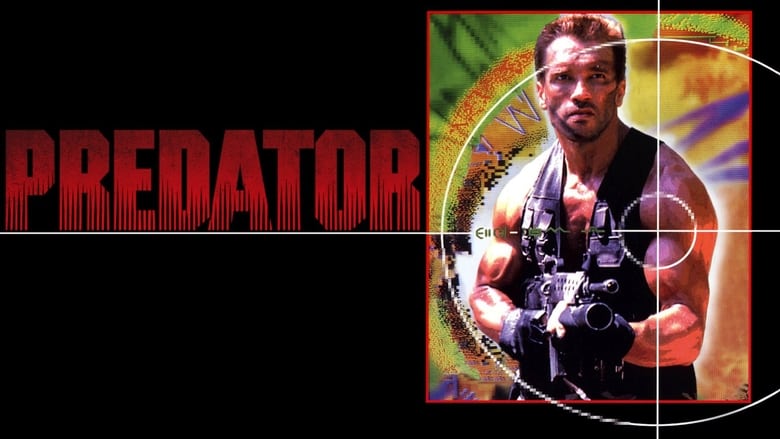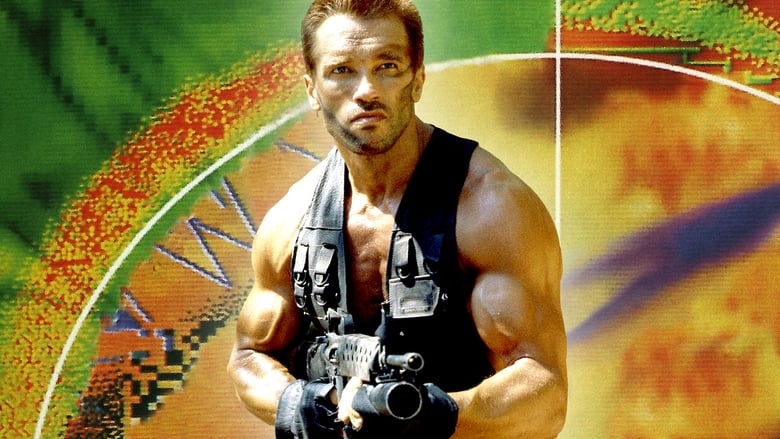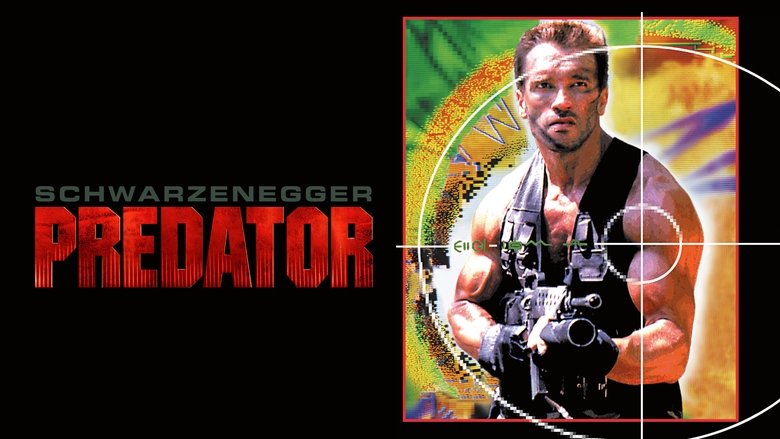Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- Start 27.08.1987
- 107 Min ActionSci-FiAbenteuerThriller
- Regie John McTiernan
- Drehbuch Jim ThomasJohn Thomas
- Cast Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, R.G. Armstrong, Shane Black, Kevin Peter Hall, Steve Boyum, William H. Burton Jr., Franco Columbu, Peter Cullen, Henry Kingi, Sven-Ole Thorsen
Kritik
Fazit
Kritik: Pascal Reis
Beliebteste Kritiken
-

Kritik von DVDMAX
Kultstreifen aus den 80er Jahren, der Terminator zusammen mit Apollo Creed, und dazwischen Testosteron Cowboys welche dann auch gleich Minigun's um die Hüften schnallen, man gönnt sich im Dschungel ja sonst nichts. Klassische Linie....ein Auftrag, geht schief, es kommt noch schlimmer.....Auferstehung, Finale. Ein hohes Tempo,...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×