Quelle: themoviedb.org
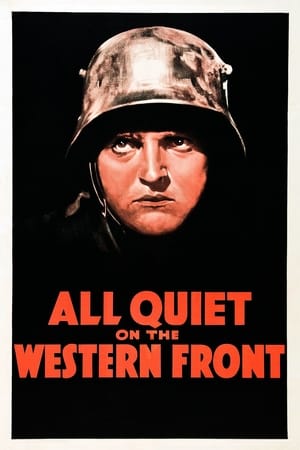 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org
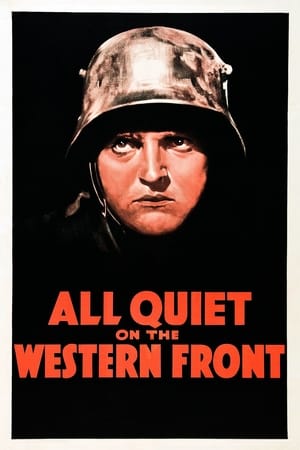
- Start 04.12.1930
- 140 Min DramaKriegsfilm USA
- Regie Lewis Milestone
- Drehbuch George AbbottErich Maria RemarqueMaxwell Anderson
- Cast Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray, Arnold Lucy, Ben Alexander, Scott Kolk, Owen Davis Jr., Walter Rogers, William Bakewell, Russell Gleason, Richard Alexander, Harold Goodwin, Slim Summerville, G. Pat Collins, Beryl Mercer, Edmund Breese
Inhalt
Kritik
Fazit
Kritik: Dominic Hochholzer
Beliebteste Kritiken
-
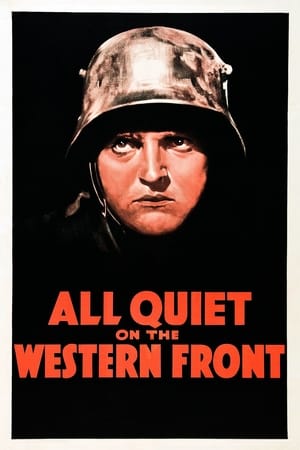
Kritik von lori007101
Im Westen absolut etwas Neues!Dieser Oscarfilm ist alles andere als schön. Denn Lewis Milestone beschönigt den Krieg nicht. Nein, er zeigt ein Bild der Hölle. Das müssen auch die jungen Soldaten merken. Am Anfang wird der Krieg hochgejubelt, bis die jungen an der Front stehen und zusehen, wie das Leben im Bach runtergeht...
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×







