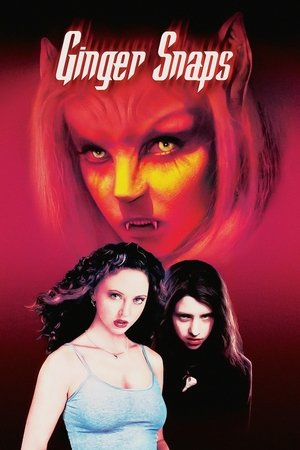Bevor „Maggie“ seinen Produktionsstart feiern konnte, stand das Drehbuch zum Film auf der „Blacklist“. Das ist eine Liste, die die jährlich besten, aber nicht produzierten Drehbücher nennt und man muss gestehen, dass die schriftliche Vorlage zum Film zu gut ist, um in den Untiefen der Hollywood-Keller zu verstauben. Für knappe fünf Millionen Dollar wurde der Film dann, mit Beihilfe von Mr. Universum, produziert und schafft es sogar, den Betrag voll und ganz auszuschöpfen, ohne je visuell qualitativ einzuknicken.
Das Zombie-Genre ist momentan überaus gefragt, im Fernsehen wie im Kino, und freut sich jährlich über immer mehr Vertreter von allerdings oft fragwürdiger Qualität. Wie in Filmen dieser Art üblich, findet auch „Maggie“ seinen Ausgangspunkt in einem Endzeitszenario am Abend der Menschheit. Die erste Einstellung zeigt eine untergehende Sonne, die den Himmel blutrot färbt. Dazu gesellt sich auf klanglicher Ebene ein entferntes Donnerrollen, das weich, leicht, aber von langer Dauer ist und auch quasi in jeder Szene des Filmes zu hören ist. Es ist das Herannahen der Kraft der Natur, die nicht aufgehalten werden kann und stärker als die Natur des Menschenverstandes ist. Anders als in den üblichen Zombiefilmen liegt hier in dem „Amerika danach“ keine eklatante Verschiebung der sozialen Werte vor. Und das ist wohl das Interessanteste am Film; Maggie wird nach ihrer Diagnose nicht einfach irgendwas präventiv in den Kopf gepflockt und dann verbrannt. Sie darf ausnahmsweise ein paar Tage bei ihrer Familie verbringen, da die Verwandlung zum untoten Geschöpf bis zu sechs Monate dauern kann. Sie bekommt eine Chance zum Abschied. Eine solche Menschlichkeit ist in diesem Genre selten; hier herrscht weder Anarchie noch eine Despotie.
Hier herrscht (noch) das Leben, wie es in gewissen Maßen auch vorher war, mit dem Unterschied, dass die Wirtschaft nicht mehr läuft und das Leben ein wenig eingeschränkter vonstatten geht. Aber ein „Fressen oder gefressen werden“ im Endstadium liegt hier nicht vor. Plündereien, Rumtreiberei und Diebstahl gibt es nicht. Arnie legt einen Dollar auf die Theke in einer verlassenen Tankstelle. Auch wird die Familie nicht von Fremden terrorisiert, die auf ihren Besitz aus ist. Das Motiv für einen Mord ist noch immer Rache und nicht der eigene existenzielle Vorteil. Nein nein, Liebe, Freiheit, Ruhe und Vernunft sind größtenteils noch intakt in diesem Land. Es geht diesem Film weniger um den Makro- und mehr um den Mikrokosmos. Es geht um Maggie selbst. Es geht darum, dass ihr die Zeit nach der Adoleszenz, die sie nicht einmal komplett durchleben darf, gestohlen wurde. Sie wird niemals erwachsen sein, niemals eine eigene Familie haben und ihren Kindern im Garten zuschauen. Wie wenig sie haben wird, wird ihr in einer Phase deutlich gemacht, in der nichts unmöglich scheint, Träume noch Träume sein dürfen und die Euphorie gerne mal überschwappt. Eine bittere Wahrheit, die Regisseur Hobson in einer sehr guten Szene einfängt: Maggie schaukelt, scheint abzuheben, zu schweben und den Horror hinter sich zu lassen. Sie lächelt zum ersten und vorletzten Mal, bis das Schöne von plagenden Visionen mit einem Schlag verdrängt wird.
Abigail Breslin ist für ihre Arbeit an diesem Film absolut zu loben. Sie schafft es, einen sehr natürlichen Eindruck zu hinterlassen als Tochter, die mit etwas konfrontiert wird, das größer ist als alles, was sie bis jetzt erlebt hat und alles, was sie und ihre Familie je erleben werden. Sie schwankt zwischen Frust, Furcht und dem Bedürfnis, ihre Familie in ein paar verzweifelten Versuchen trotz der Umstände glücklich zu machen. Man leidet mit, in den vielen ruhigen Szenen, die Maggie gehören. Nicht, weil alles künstlich aufgeplustert und überdramatisiert wird, sondern weil die Leere in Breslins Augen so greifbar, nah und irgendwie bekannt ist. Ihr Leinwandkompagnon ist selbstverständlich mit offenen Armen zu empfangen und dafür zu loben, dass er sich von seinem Image entfernt und hier einen ruhigen, überlegten und liebenden Part verkörpert. Aber es war immer so und es wird wohl immer so bleiben: Sobald Arnold Schwarzenegger den Mund aufmacht, sind Hopfen und Malz verloren. Er spielt den Vater, der weiß, was mit seiner Tochter geschehen wird und es nicht über das Herz bringt, sie den Behörden zu übergeben. Nicht nur Vater, sondern auch bester Freund, der nicht viel zu machen scheint in der kurzen Laufzeit, und dennoch eine überaus tragende Rolle für seine Tochter spielt.
„Maggie“ ist ein überaus interessanter Film, der mittels Bild und Ton eine voll und ganz stimmige Atmosphäre aufzubauen und aufrecht zu erhalten weiß. Während grundlegend inhaltlich andere Wege gegangen werden, als für das Genre üblich, schleichen sich doch immer wieder einige Klischees und altbekannte Elemente ein, die bei ihrem Erscheinen einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Verlässt man die Oberfläche und untersucht die tiefergreifende Ebene des Filmes, so findet man vor allem zum Anfang einige Momente und Sätze, die den Kopf erst einmal nicht verlassen werden. Leider verringert sich der Mehrwert des Films nach einer guten halben Stunde und kommt zwischenzeitlich gar zu einem Stillstand. Seltsamerweise gelingt dem Film jedoch das Kunststück, ein ganz und gar fesselndes, wenn auch visuell altbekanntes Ergebnis auf die Beine zu stellen, das anfangs interessiert, mittelfristig unterhält und am Ende gar berührt.