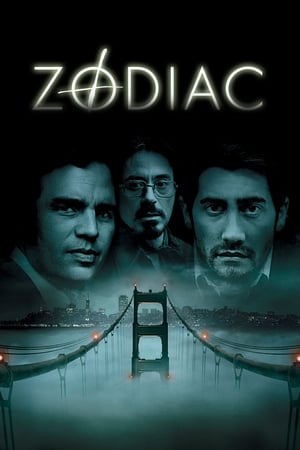Quelle: themoviedb.org
 Trailer
Quelle: themoviedb.org
Trailer
Quelle: themoviedb.org

- Start 11.11.1999
- 139 Min Drama
- Regie David Fincher
- Drehbuch Chuck PalahniukJim Uhls
- Cast Edward Norton, Brad Pitt, Meat Loaf, Zach Grenier, Richmond Arquette, David Andrews, George Maguire, Eugenie Bondurant, Christina Cabot, Helena Bonham Carter, Sydney 'Big Dawg' Colston, Rachel Singer, Christie Cronenweth, Tim DeZarn, Ezra Buzzington, Dierdre Downing-Jackson
Kritik
Fazit
Kritik: Jacko Kunze
Beliebteste Kritiken
-

Kritik von happyondr
David Finchers bis dato interessantester Film stellt sich als eine filmische Übersetzung des Nietzsche-Werks Die fröhliche Wissenschaft gut sichtbar in das Schaufenster anthropozän'scher Kritik, d.h. in allererster Linie ein Versuch der Ablehnung der vom Menschen verursachten Prozesse auf der Erde- Im Falle von FIGHT CLUB, de...
-

Kritik von silab
Grandioser Film
-

Kritik von Fairelane
Der Film ist wirklich stark, da etwas anders als der übliche Mainstream. Gute Besetzung, wobei Brad Pitt klar obenaus schwingt.
Moviebreak empfiehlt
Wird geladen...
×